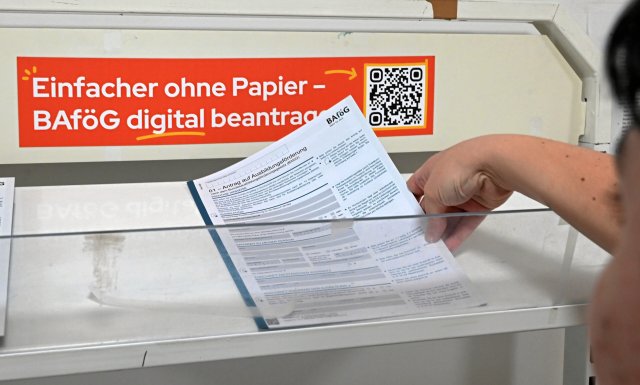- Politik
- Bildungskrise
Kinder in der Kälte des Systems
Ein Kongress der Linken im Bundestag diskutiert Wege aus der Kitakrise

Eine solche Veranstaltung war im Bundestag etwas Besonderes. Dort, wo sonst die Abgeordneten in Ausschüssen tagen, diskutierte am Donnerstag die Linksfraktion mit rund 230 Gästen über Ganztagsbetreuung, sinkende Kinderzahlen und Sprachdiagnostik. »Ein Kita-Gipfel findet nicht im Kanzleramt statt«, sagte Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag. Die Spitze zielte auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der zuletzt Vertreter der Stahlindustrie und zuvor im Oktober die Autobranche eingeladen hatte, um über deren Probleme zu sprechen.
Die Linke nutzte den Tag der Kinderrechte im Paul-Löbe-Haus, um gemeinsam mit Erzieher*innen, Gewerkschafter*innen, Kommunalpolitiker*innen und Verbänden über die Krise der frühkindlichen Bildung zu debattieren und Lösungsansätze zu entwickeln.
Das Kindeswohl im Blick
Es war ein Gipfel der Basis – in Sichtweite zum Kanzleramt. Reichinnek kritisierte, dass die Belange der Kinder nicht den Stellenwert hätten, den sie haben müssten. Wenn Kitas unzuverlässig seien, könnten vor allem Mütter nur eingeschränkt oder gar nicht arbeiten. Dadurch blieben erhebliche Potenziale ungenutzt. Reichinnek verwies auf eine Schätzung der Plattform Stepstone, die von wirtschaftlichen Kosten in Höhe von 23 Milliarden Euro ausgeht, wenn Eltern nicht wie gewünscht arbeiten können.
Doch diese ökonomische Perspektive, die Teile der wirtschaftspolitisch orientierten Bundesregierung zum Nachdenken bringen könnte, sollte auf dem Kongress nicht im Mittelpunkt stehen. Die Linksfraktion wollte vor allem die Sicht der Kinder einnehmen – jener Gruppe, die unter zu engen Räumlichkeiten, fehlender Zuwendung oder außerplanmäßigen Schließungen besonders leidet. Betroffene Fachkräfte schilderten auf dem Kongress einen »permanenten Ausnahmezustand«.
Der Sozialwissenschaftler Nikolaus Meyer von der Hochschule Fulda sprach in seinem einleitenden Vortrag angesichts der vielen Mängel und dem gleichzeitigen Streben nach Effizienz von einem »kalten System« – einem Betreuungsrahmen, der weder den Kindern noch dem Personal gerecht werde. Er nahm in seiner Analyse die Perspektive der Fachkräfte ein, die mehrfach auf dem Kongress belastende Situationen schilderten.
Berichte aus der Praxis
Eine solche erlebte die Berliner Erzieherin Juliane Eisenbruch. Kurz vor Weihnachten hätten sich vier von acht Kolleg*innen krankgemeldet, berichtete sie auf dem Podium. Dann fielen kurzfristig drei weitere aus, sodass sie plötzlich allein für 42 Kinder verantwortlich gewesen sei – ein traumatisches Ereignis. Sie habe mit den Eltern gesprochen, »die mussten letztlich die Situation auffangen«.
Überforderungen gehörten vielerorts zum Alltag, erklärte Meyer. Obwohl Erziehungswissenschaftler*innen empfehlen, den Personalschlüssel bei über Dreijährigen nicht über 1 zu 7,5 steigen zu lassen, erlauben die Kita-Gesetze der Länder durchweg größere Gruppen. Meyer verwies auf eine Verdi-Befragung, nach der sich eine Fachkraft häufig um 13 oder sogar 20 Kinder kümmern muss. Zugleich gebe es eine schleichende Erosion der Qualifikation: Immer mehr Beschäftigte seien Hilfskräfte.
»Das verändert selbstverständlich die Einrichtungen«, sagte Meyer. In einer Umfrage von Verdi und der Hochschule Fulda klagten viele Erzieher*innen über ein miserables Teamklima. 62 Prozent hätten bereits psychische Gewalt erlebt, 27 Prozent sogar körperliche Übergriffe. Für Meyer kein Wunder: In einem Beruf mit hohen moralischen Ansprüchen gingen viele täglich über ihre Grenzen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Vielerorts fehle der Raum für Austausch und Reflexion, das führe zu einer Atmosphäre der »sozialen Kälte«.
Eine unverhoffte Chance für konkrete Verbesserungen könnte sich jetzt auftun. Seit einigen Jahren sinkt nämlich die Geburtenrate in Deutschland, was inzwischen auch in der Kinderbetreuung spürbar ist. Immer häufiger bleiben Plätze unbesetzt. Vereinzelt müssen Tagesmütter ihr Angebot aufgeben, und erste Kita-Träger haben schon Insolvenz angemeldet. Während noch vor Kurzem bundesweit zehntausende Plätze fehlten, könnte sich diese Lage nun wandeln.
Ulrike Grosse-Röthig, Landtagsabgeordnete der Linken in Erfurt, befürchtet, dass mit dem sinkenden Bedarf ein Abbau der Infrastruktur einhergehen könnte. Vor allem die ländlichen Regionen könnten davon schon bald betroffen sein. Das wäre ein fataler Schritt, so Reichinnek, und politisch kaum zu vermitteln. Der Tenor des Kongresses war daher eine klare Aufforderung an die Politik von Bund und Ländern, den demografischen Wandel zu nutzen, um Betreuung in kleineren Gruppen zu ermöglichen.
Die entstehenden Mehrkosten hierfür seien überschaubar, betonte Grosse-Röthig. Lediglich die in einigen Bundesländern noch erhobenen Elternbeiträge würden wegfallen. Der Geburtenrückgang biete somit die Chance, die Qualität der Einrichtungen deutlich zu verbessern. Immer wieder wurde auf der Tagung ein bundesweit geltendes Kitaförderungsgesetz sowie ein einheitlicher Personalschlüssel gefordert. Beides ist von der Bundesregierung und den Ländern derzeit nicht geplant.
Ungeachtet der Frage nach den Zuständigkeiten seien grundlegende Verbesserungen jedoch nur möglich, so Sozialwissenschaftler Meyer, wenn die Kindertagesbetreuung endlich als zentrale gesellschaftliche Infrastruktur betrachtet wird. Kaum vermittelbar sei es, dass der Straßenbau als unverzichtbar gilt, während Kitas politisch vernachlässigt werden – obwohl Eltern dadurch weniger arbeiten können, Personal ausbrennt und Kinder dort nur unzulänglich die Grundlagen für ihr späteres Leben erwerben.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.