- Politik
- 35 Jahre Rosa-Luxemburg-Stiftung
Empowerment für das linke Spektrum
Daniela Trochowski zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die gerade ihren 35. Geburtstag feierte

Nach einem Jahrzehnt als parteiübergreifend anerkannte Finanz-Staatssekretärin in Brandenburg haben Sie im Jahr 2000 die Geschäftsführung der Rosa-Luxemburg-Stiftung übernommen. Wie oft haben Sie denn in den vergangenen fünf Jahren diesen Wechsel bereut?
Noch nie. Auch wenn die letzten Jahre ziemlich hart waren. Aber es ist einfach eine unheimlich spannende Arbeit. Und zugleich ein riesiges Privileg, in so einer Organisation arbeiten zu können, die den eigenen politischen Grundansichten und Grundwerten entspricht, in der man sich für diese Überzeugungen einsetzen kann und von so vielen engagierten Kolleg*innen umgeben ist. Wir unterhalten uns zwar gerade hier in der Bundesstiftung, aber die RLS hat ja auch 16 Landesstiftungen und 26 Auslandsbüros. Also ein riesiges Feld nicht nur an Arbeit, sondern auch an Potenzial, Eindrücken, Netzwerken und an Menschen, die man kennenlernt. Deshalb habe ich den Wechsel keine Minute bereut.
Die Stiftung hat gerade ihren 35. Geburtstag gefeiert. Was bleibt unter dem Strich nach dreieinhalb Jahrzehnten?
Ich glaube, der größte Erfolg ist, dass es uns in dieser Stärke heute gibt. Dass wir als Stiftung eine große Wirkung in der Öffentlichkeit haben, gerade im linken Spektrum der Gesellschaft. Das haben sich unsere Gründungsväter und -mütter, als sie vor 35 Jahren in Berlin-Mitte die Stiftung gegründet haben, so sicher nicht vorstellen können. Obwohl sie schon weitergedacht haben als viele von uns. Michael Brie, Evelin Wittich und die vielen anderen haben schon damals überlegt, wie sie die sozialistische Idee – eines Sozialismus, der sich deutlich von dem unterscheiden sollte, der gerade niedergegangen war – weiterentwickeln und vor allem auch für die Praxis nutzbar machen können. Das tut außer der Stiftung in dieser Gesellschaft bis heute niemand! Die Gründer*innen waren bereits im November 1990 mit dem Modell der politischen Stiftungen vertraut und nutzten dieses, um ihre inhaltlichen Ziele in eine institutionelle Hülle zu kleiden. Das war damals besonders klug und vorausschauend.
Welche Fixpunkte sind in die Geschichte der Luxemburg-Stiftung eingegangen?
Einer der größten und wichtigsten Schritte war 1996 die Anerkennung durch die damalige PDS als der Stiftung nahestehende Partei. Den ersten Zuwendungsbescheid öffentlicher Mittel erhielten wir im August 1999. Bereits im November dieses Jahres haben wir die ersten fünf Stipendiat*innen gefördert. Deren Zahl ist kontinuierlich gewachsen auf aktuell 1000. Zur Erfolgsgeschichte gehören auch 4300 »Ehemalige«, die vielen Kampagnen, Studien, Publikationen, Veranstaltungen und, und, und. Aber es geht nicht um einzelne Höhepunkte, sondern um eine kontinuierliche Arbeit seit Jahrzehnten.
Daniela Trochowski, geboren 1969, studierte nach einem Volontariat bei der »Freien Presse« im damaligen Karl-Marx-Stadt Wirtschaftswissenschaften. Nach einem Abstecher in die Wirtschaft arbeitete sie in einer Berliner Senatsverwaltung und in der Bundestagsfraktion der Linkspartei. Ab 2009 war sie Staatssekretärin für Steuern und Finanzen in Brandenburg. Im November 2019 wurde sie zum Geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewählt und trat diese Funktion am 1. Februar 2020 an.
Kontinuierliche Arbeit … Wie sieht denn das täglich Brot in der Stiftungsarbeit aus?
Unser täglich Brot ist sehr vielfältig. Um im Bild zu bleiben: Wir sind so ein bisschen wie eine Bäckerei mit ganz vielen verschiedenen Angeboten. Als Organisation sind wir ein Thinktank, aber zugleich, und das ist unsere Hauptaufgabe, eine politische Bildungsträgerin. Unsere Aufgabe ist es, Menschen wie du und ich mit Wissen, mit Fakten auszustatten, damit sie ihre politischen Entscheidungen auf Basis dieses Wissens fällen können. Und da hängt natürlich unheimlich viel dran: Analysen zu gesellschaftlichen und ökonomischen Prozessen, historische Forschung zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte und der Zeit nach der Wende und vieles mehr.
Klingt ein bisschen nach Schule.
Es ist natürlich wichtig, Bildungsformate zu entwickeln, sowohl für junge Leute als auch für die Mittelalten und Älteren. Und es geht um Formate für Teamer*innen, die in linken Kreisen unterwegs sind, ob das Organisationen sind oder direkt die Partei. Ich nenne das Empowerment von Menschen im linken Spektrum.
Stichwort Linkspartei. Wie läuft die Zusammenarbeit ganz praktisch? Wird aus dem Karl-Liebknecht-Haus oder der Bundestagsfraktion angeklopft und gefragt, ob die Stiftung nicht dieses oder jenes Thema bearbeiten könnte? Oder setzt die RLS Themen, die von der Linken aufgegriffen werden?
Einerseits liegt es natürlich ein Stück weit in unserer DNA, dass wir uns mit ähnlichen oder analogen Themen beschäftigen und diese setzen, wie es Die Linke auch macht. Wir sind eine linke Stiftung und bestimmten linken Fragen, den sozialen Themen, der Friedensfrage, dem Kampf gegen rechts oder dem sozial-ökologischen Wandel allein schon durch unseren inhaltlichen Auftrag, den wir uns selber gegeben haben, verpflichtet. Insoweit gibt es ohnehin per se eine Analogie mit der Linken. Es gibt aber auch einen sehr engen Austausch zwischen der Partei, der Fraktion und uns. Dabei besprechen wir miteinander, wie unsere Strategien sind und welche Themen wir wie bearbeiten. Und da hat jeder eine andere Funktion in diesem Dreigestirn.
Welche Funktion ist die der Stiftung?
Ich glaube, dass man von uns sagen kann, dass wir die breiteste inhaltliche Aufstellung in diesem Dreieck haben, und das ist auch richtig so. Wir sind der Linken als Partei nahe, sprechen aber darüber hinaus auch die gesellschaftliche Linke und andere progressive Kräfte an. Das ist unser großer Vorteil. Es geht nicht darum, Menschen für die Partei zu gewinnen, sondern wir wollen das linke Spektrum in der Gesellschaft insgesamt stärken. Da sind wir oft ein Türöffner für Die Linke.
Die Stiftung ist also so eine Art Vorhut der linken Realpolitik?
Sagen wir es so: Wir können viel strategischer denken, als das zum Beispiel objektiv bei der Bundestagsfraktion möglich ist, denn diese ist ja sehr stark an die parlamentarische Arbeit gebunden. Aber natürlich gibt es Wechselwirkungen. Beim Thema Mieten zum Beispiel liegt es auf der Hand, dass wir zwar keine direkten Projekte gemeinsam umsetzen, aber unsere Erkenntnisse fließen in die Arbeit unserer Abgeordneten im Bundestag, in den Landtagen und in den Kommunalparlamenten ein. Der Mietendeckel ist so ein Beispiel, bei dem man sagen kann, da hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung die Debatte angestoßen. Wir waren die Ersten, die überhaupt über dieses Thema gesprochen haben auf Basis von Analysen, auf Basis von Erhebungen. Ein anderes Beispiel ist der Kampf gegen rechts. So waren wir viele Jahre bei der Aufarbeitung des NSU-Komplexes aktiv und haben aus den Erkenntnissen unter anderem Bildungsformate in den Landesstiftungen entwickelt.
Die Forschungsergebnisse oder Studien der RLS haben direkten Einfluss auf die Politik der Bundestagsfraktion oder der Linkspartei generell?
Ich würde sogar sagen, bei bestimmten Themen über die Bundestagsfraktion und über die Partei hinaus. Auch bei politischen Akteuren in der Gesellschaft. Manchmal, um wieder beim Thema Mieten und Wohnen oder auch Gesundheit und Pflege zu bleiben, dauert das natürlich ein bisschen, bis es ankommt bei den politischen Akteuren. Aber man kann mindestens sagen, dass wir einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass sich das, was wir an Erkenntnissen haben und auch an Studien veröffentlichen, dann im politischen Agieren auf unterschiedlichen Ebenen niederschlägt. Auch in jenem von Gewerkschaften und anderen Organisationen.
Sie haben vom linken Spektrum gesprochen, das viel größer ist als die Linkspartei. Wie funktioniert es, dieses Spektrum anzusprechen?
Das gelingt uns mit ganz unterschiedlichen Formaten. Im Inland sind unsere Landesstiftungen dabei ein ganz wichtiger Teil unserer Außenwirkung. Denn in die Fläche hineinzuwirken, ist natürlich von Berlin aus schwieriger. Unsere Landesstiftungen kennen dagegen die Regionen, sie kennen die politischen Probleme, sie arbeiten mit Projektpartnern vor Ort zusammen. Da wird sehr viel mittels Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, auch Broschüren und Informationsmaterial getan. Übrigens: Verstärkt auch zur Wirtschaftsproblematik. Ein wichtiger Türöffner sind kulturelle Angebote. Dazu zählen Filmvorführungen im Rahmen des jährlichen Hofkinos am FMP1, Ausstellungen, beispielsweise zum Agieren der Treuhandanstalt oder zum Leben und Wirken von Stefan Heym sowie die Reihe »linksbündig«, die linken Autor*innen eine Plattform bietet.
Und welche Rolle spielen die knapp 30 Auslandsbüros der Stiftung dabei?
Die internationale Arbeit ist uns sehr wichtig. Einerseits, um Erkenntnisse und Erfahrungen aus den über 80 Ländern, in denen wir tätig sind, in die bundesdeutsche Debatte einzubringen. Andererseits pflegen wir in den Ländern und Regionen Netzwerke, unterstützen gewerkschaftliche, linke, fortschrittliche Kräfte. Natürlich werden unsere Büros auch in Veranstaltungen hierzulande einbezogen. Unsere sehr große Konferenz »Good Night Far Right – Strategien gegen rechts« dieses Jahr wäre ohne die Unterstützung unseres Auslandsbereiches und der internationalen Büros in dieser Form gar nicht möglich gewesen.
Es gibt in einigen europäischen Ländern Linksparteien, die eigene Stiftungen unterhalten. Gibt es mit diesen Kooperationen?
Mit »Transform! europe«, dem Netzwerk von 38 europäischen Organisationen aus 22 Ländern, haben wir eine sehr intensive Zusammenarbeit. Das ist die Stiftung der Europäischen Linkspartei, in der viele linke und links-grüne Parteien zusammenarbeiten. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieses Stiftungsmodell, wie wir es in Deutschland haben, schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Es gibt in keinem anderen Land dieses Modell parteinaher, öffentlich finanzierter Stiftungen.
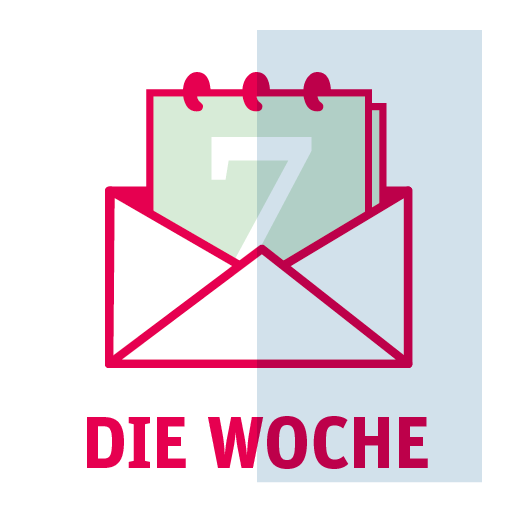
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Das klingt sehr nach einer Erfolgsgeschichte. Aber noch vor ein paar Monaten wusste in der Stiftung niemand, wie es weitergeht. Durch das schlechte Abschneiden der Linkspartei bei Wahlen ist auch die RLS in die Krise geschlittert.
Das Stiftungsgesetz sagt, dass aus den letzten vier Wahlergebnissen der »nahestehenden Parteien«, also in unserem Falle der Linken, ein arithmetisches Mittel gebildet wird. Und dieses Mittel ist dann der Finanzierungsanteil der jeweiligen Stiftungen. Diese Mittel kommen aus dem Innen- und Außenministerium, dem Bundesentwicklungsministerium, aus dem Bundesforschungsministerium. Geregelt ist, dass eine Partei mindestens dreimal im Bundestag vertreten sein muss, damit die Stiftung überhaupt Gelder bekommt. Das ist bei uns der Fall. Aber die Stimmverluste für Die Linke bei der Bundestagswahl 2021 haben das arithmetische Mittel gedrückt und drücken es auch weiterhin. Die Konsequenz: Zum ersten Mal in der Geschichte der Stiftung ist unsere öffentliche Finanzierung gesunken. Und zwar um zwei Prozentpunkte von 10,6 auf 8,5 Prozent. Das klingt jetzt nicht besonders viel, ist aber eine Summe, die fehlt. Nach dem ersten Schock war klar, wir müssen handeln, um die Existenz der Stiftung zu sichern.
Welche Spuren hat die Finanzkrise in der Stiftung, insbesondere auch unter den Beschäftigten, hinterlassen?
Eine solche Entwicklung geht nicht spurlos an einer Organisation vorbei – weder an unseren Kolleg*innen noch an den Leitungen oder an uns in der Geschäftsführung. Es war ziemlich schnell klar, dass ohne Stellenabbau die Stiftung nicht überleben kann. Es ging im vergangenen Jahr konkret um 80 Stellen. Das hat zu tiefem Frust und großer Verunsicherung geführt. Grundlage des Stellenabbaus sollte eine Sozialauswahl und ein mit dem Betriebsrat gut ausverhandelter Sozialplan sein. Im Februar hat Die Linke dann bei der vorgezogenen Bundestagswahl gut abgeschnitten, sodass wir gemeinsam mit dem Betriebsrat die Stellenstreichungen nach unten korrigieren konnten. Und ebenso erwähnen möchte ich, dass viele Kolleg*innen sich sehr solidarisch gezeigt haben. Im Frühjahr hatten wir einen Tarifvertrag abgeschlossen zur solidarischen Arbeitszeitreduzierung und konnten damit auch Beschäftigungsverhältnisse retten. Unterm Strich mussten wir niemandem betriebsbedingt kündigen. Das war eine große Erleichterung für uns alle.
Wagen Sie einen optimistischen Blick ins nächste Jahr? Welche Höhepunkte stehen 2026 an?
Zunächst haben wir am Wochenende unsere Mitgliederversammlung, bei der wir gemeinsam die Strategie der Stiftung beraten und den Vorstand neu wählen. Und dann geht es nach unseren jetzigen Vorstellungen im kommenden Jahr Schlag auf Schlag: Das »Festival de:lux« mit Kultur und Kontroverse im März, dem Geburtstagsmonat von Rosa Luxemburg, eine große Konferenz zur Wohn- und Mietensituation im Mai in Berlin, unser internationales Festival für Politik, Bildung und Kultur »über:morgen – the world transformed« im Juni in Potsdam, weitere Konferenzen zum Feminismus und zur Friedensproblematik sind nur einige Punkte. Aber, um etwas Werbung zu machen: Das aktuelle Programm findet sich natürlich auf unserer Webseite.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.






