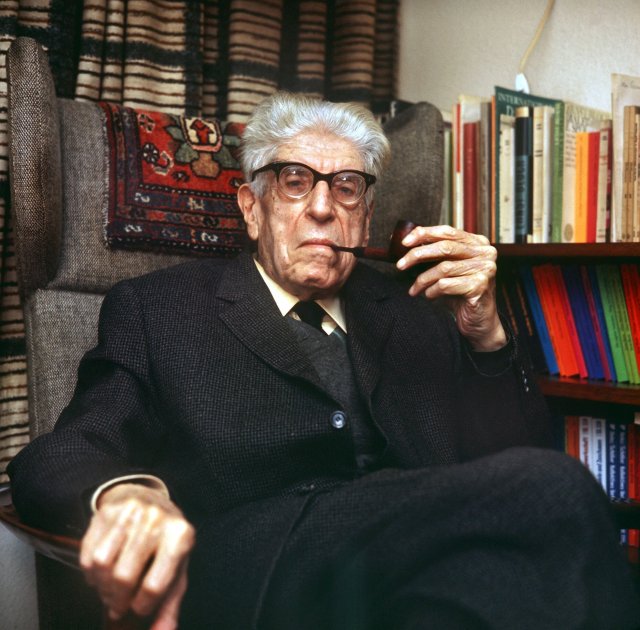Skaten ist wie Tanzen
»This ain't California« - Regisseur Marten Persiel und Produzent Ronald Vietz zur Diskussion um den Film
Marten Persiel: Ich habe gehofft, dass die Diskussion kontrovers geführt wird, aber nicht mit der Lust gerechnet, dies schlecht zu machen. Dokumentarische Mischformen sind seit zehn Jahren auf dem Markt, für unseren Film haben wir den Begriff dokumentarische Erzählung gefunden. Der Film sieht von der Machart her wie ein Dokumentarfilm aus. Dramaturgisch aufgebaut und inhaltlich angereichert ist er wie eine Erzählung. Er überspitzt Fakten, verdichtet, er setzt bewusst Wendungen und will das Herz berühren. Wir sprechen nicht vornehmlich den Kopf an, wir wollen keine Doktorarbeit über Underground-Sport in der DDR bieten.
Ronald Vietz: Ich möchte nicht, dass die Zuschauer mit dieser akademischen Herangehensweise belastet werden. Sie sollen sich auf den Film einlassen, hinterher beantworte ich gerne alle Fragen. Und die Leute, die aus dem Kino kommen, sind begeistert. »Tagesschau«-Moderator Jens Riewa zum Beispiel lobte, endlich haben die Ostler eine andere Sprache, die berlinern, die sind nicht mehr doof.
Im Zentrum des Films steht die Erinnerung an »Panik«, der wildesten Skater Ostberlins, der 2011 als Soldat in Afghanistan gefallen sein soll. Gibt es ihn wirklich oder ist die Lebensgeschichte aus mehreren Schicksalen zusammengesetzt?
Persiel: Der Skater Panik ist in Afghanistan gefallen, die Eckpunkte seiner Biografie stimmen. Treffen konnte ich ihn nie und so stückeln wir zusammen, woran sich seine Freunde erinnern. Das ist zum Teil ganz unterschiedlich, das fängt schon bei den Daten an. Wir haben nur manchmal übertrieben. Er hat wohl in einer Turnhalle gezündelt, in der Filmanimation brennt sie ab. Insgesamt ist die Figur aus erzählerischen Gesichtspunkten so hingemodelt, dass sie funktioniert.
Vietz: Dem Film ging eine lange Recherchephase voraus. Wir haben uns an den Fakten orientiert, wichtiger war mir, das Lebensgefühl und die eigene Erfahrung der DDR wiederzufinden. Der Film sollte schön sein, es sollte 'rüberkommen, wie ich die DDR erlebt habe. Wie es war und nicht wie es von außen gesehen wurde oder heute betrachtet wird. Diese plakativen Bilder von marschierenden Kindern sind ja richtig, aber dort lebten Menschen. Und die nehmen sich ihren Freiraum, die wollen ihren Spaß haben und ihr eigenes Leben gestalten.
Damit ist es auch ein Film gegen die einseitige Erinnerung an die DDR?
Vietz: Die Realität in der DDR wird oft völlig undifferenziert dargestellt. Ich habe meine Jugend dort verbracht, Probleme haben wir im Osten erst bekommen, als wir älter wurden. Und ja, wir hatten eine eine tolle Zeit, wir haben uns unsere Freiheiten genommen und sind dabei an Grenzen gestoßen, die uns geprägt haben. Heute habe ich manchmal das Gefühl, ich muss meine eigene Herkunft verleugnen und sie doof finden. Doch egal wie die äußeren Umstände aussahen, es wächst eine Heimatliebe: Zu dem Ort, wo man aufgewachsen ist, zu Menschen wie meinen Großeltern, die mich geprägt haben. Und man wird doch äußern dürfen, dass man dies vermisst, ohne gleich schräg dafür angeguckt zu werden.
Persiel: Ich gehöre ja zur gleichen Generation wie die porträtierten Skater. Für mich war es kein so großes Problem, an ein Board zu kommen, also musste ich mir vorstellen wie es gewesen sein könnte, wenn ich nicht ins Kaufhaus gehen kann und mir selbst das Board basteln muss. Viel interessanter war für mich herauszufinden, ob die Skater in Ost und West die gleichen Motive hatten. Skaten ist ja eine unmittelbare Interaktion mit der natürlichen Umgebung, es gibt nur mich, den Stein, die Kante, die Schräge. Alles andere wird unwichtig. Es ist weltweit Ausdruck des gleichen kindlichen Bedürfnisses nach Freiheit und Unangepasstsein.
Vietz: Das Skaten war für uns beide eine emotionale Brücke, über die wir uns austauschen konnten. Das Skaten in Afghanistan hat heute zum Beispiel eine viel größere gesellschaftliche Dimension als hier. Die Kinder werden komplett aus dem Alltag entführt, sie sind frei von Vorgaben und Ideologien, sie vergessen ihre Spielzeugpistolen, die Mädchen dürfen mitmachen, weil Skaten als Spiel und nicht als Sport gilt. In dem Moment, in dem ich auf dem Board stehe, ist man aus dem System raus. Das ist ziemlich einzigartig unter den Sportarten.
Erklärt sich daraus die Ablehnung von Vereinen und Wettbewerben?
Persiel: Wenn man sich misst, repräsentiert man automatisch. Dein Team, dein Land, das geht beim Skaten nicht. Auch im Westen scheiterten alle Versuche, Skater in Vereinen zu organisieren.
Vietz: Das Unorganisierte ist doch das Schöne am Skaten. Man ist frei auf der Straße unterwegs. Fußgänger haben meist ein Ziel, der Skater entscheidet spontan, wo er hinfährt in der Konfrontation mit seiner Umgebung und seinen Beobachtungen. Er ist immer frei in seiner Entscheidung und setzt sich selbstständig mit dem auseinander, was er selbst will. Das widerspricht jeder Form der Organisation.
Persiel: Am ehesten ist Skaten mit dem Tanzen zu vergleichen. Man tanzt, weil man tanzen will. Man kann sich messen, wenn man es unbedingt braucht, man kann es aber auch lassen.
Interview: Katharina Dockhorn
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.