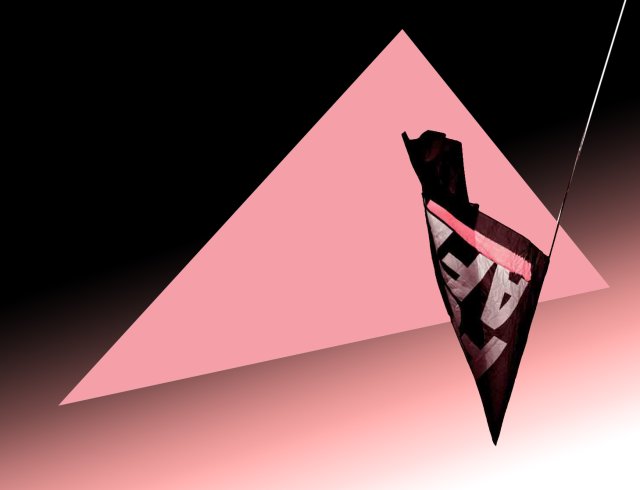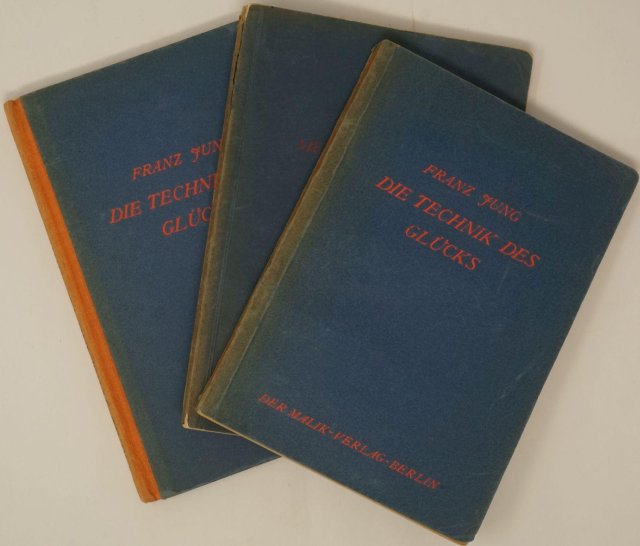- Kultur
- Literatur
Epochenbild und Spiegel der Seele
Konstantin Paustowski neu gelesen
»Beginn eines unbekannten Zeitalters«, der dritte Roman des Zyklus, wurde 1957 abgeschlossen. Schon der Einstieg mit den Bildern vom Frühling und Sommer des Jahres 1917, als Russland Tag und Nacht einer »chaotischen Volksversammlung« glich, verrät den aufmüpfigen Geist des Verfassers. Genau so hatte Pasternak, dessen Roman »Doktor Shiwago« gerade in Italien erschienen war, in seiner Lyriksammlung »Meine Schwester - das Leben« den Sommer 1917 empfunden: als eine Zeit, in der die Menschen über sich hinauswuchsen, sich als »Exponenten des ganzen Menschengeschlechts« fühlten und sich die Wege, die Bäume und die Sterne mit ihnen auf den Meetings versammelten. Paustowski solidarisierte sich mit dem Weltbild des verfemten Pasternak, wie er sich stets eher an Dichtern als an Politikern und Ideologen orientierte.
Im Sommer 1917 arbeitete er an einer Moskauer Zeitung, die von Don Aminado geleitet wurde. »Seinen richtigen Namen habe ich nie erfahren«, schreibt Paustowski, obwohl er wusste, dass der Schriftsteller Aminado 1919 emigrieren musste. Er erzählt von Andrej Belyj, Konstantin Balmont, Iwan Schmeljow und Maximilian Woloschin - jeder Zweite dieser Autoren wurde gezwungen, das Land zu verlassen. Von Bunin, dessen Bücher erst Ende der 60er Jahre heimkehren durften, sagt Paustowski, er habe für ihn »wegen seiner schonungslosen Genauigkeit, seiner Trauer, seiner Liebe zu Russland und seiner erstaunlichen Kenntnis des Volkes« zu den »Klassikern« gehört. Allein dieses Wort hatte dem nach Kolyma deportierten Dichter Warlam Schalamow 1943 zehn weitere Jahre Lagerhaft eingebracht.
Der Roman »Die Zeit der großen Erwartungen« entstand 1959. Als die Weißen im Februar 1920 Odessa verlassen und viele Menschen in blinder Angst vor den Roten auf die letzten Schiffe flüchten, entschließt sich Paustowski, sein Land und sein Volk nicht im Stich zu lassen. Hunger und Kälte drohen alle Kräfte zu lähmen, doch der Autor und seine Freunde verschaffen sich durch einen verwegenen Handstreich Arbeit und Brot. Er begegnet Ilja Ilf, der damals noch Elektromonteur war und mit Dutzenden von Gaunern zu tun hatte, die er später gemeinsam mit Jewgeni Petrow in der Figur des Ostap Bender (»Die zwölf Stühle«) an den Pranger stellte. Bei der Arbeit an der Zeitung »Morjak« trifft Paustowski Isaak Babel, der gerade eine seiner Moldawanka-Erzählungen geschrieben hat, deren Held der Bandit Genja Krik ist. Babel ist in seinen Augen ein Mann, der »äußerlich zur Skepsis, ja zum Zynismus neigte, in Wirklichkeit aber an die naive und gute menschliche Seele glaubte«. Dem jüdischen Odessa, der Arbeit Babels an der Sprache (»Jeder Satz - ein Gedanke, ein Bild, nicht mehr.«), seiner Beziehung zu Alexander Block und Eduard Bagrizki sind einige der schönsten Kapitel gewidmet. Dabei hatte in der zweiten Hälfte der 50er Jahre dank der Initiativen Paustowskis und Ehrenburgs gerade die zaghafte Rehabilitierung des ermordeten Schriftstellers begonnen.
Nicht von ungefähr bezeichnete Paustowski die frühen 20er Jahre als Zeit der großen Erwartungen. Er lässt auch durchblicken, wie sehr es ihn gereizt hätte, noch ein anderes Buch zu schreiben - nicht über sein wirkliches Leben, sondern darüber, »wie es hätte sein sollen und können, wäre nicht vieles von äußeren und oft widrigen Umständen bestimmt worden. Das wäre die Geschichte der Sehnsüchte und Träume meiner Seele geworden, eines Lebens, das alle Farben, alles Licht und alles Erregende der Welt erfahren hätte«. Doch auch in der vorliegenden Form erweist sich der autobiografische Romanzyklus als ein Buch voller Farben und Licht, ein Epochenbild, das eher ein Spiegel der Seele des Schreibenden ist als ein Bericht über das in Geschichtsbüchern gespeicherte Zeitgeschehen.
Konstantin Paustowskij: Der Beginn eines verschwundenen Zeitalters. Aus dem Russischen von Gudrun Düwel und Georg Schwarz. Eichborn Verlag. 527 Seiten, gebunden, 30 Euro .
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.