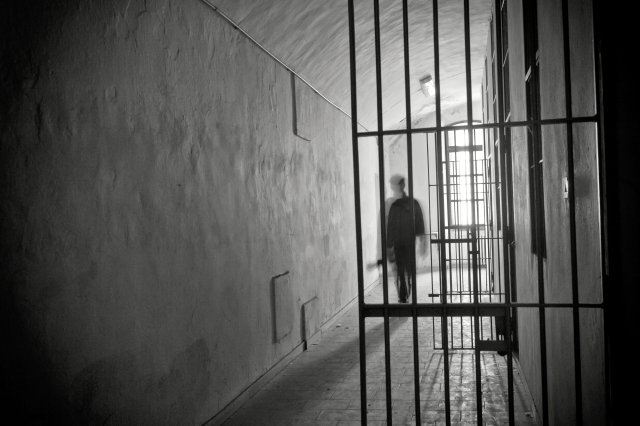Uhren aus Glashütte gehen nach wie vor
Wem die Stunde schlägt, der setzt aufs Mechanische / Fünf Sanierer und noch keine Privatisierung Von CHRISTINE HEMPEL
Am Freitag begann im Berliner Fernsehturm eine Ausstellung des Uhrenmuseums der Glashütter Uhrenbetrieb GmbH und des sächsischen Landesfremdenverkehrsverbandes. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 - 18 Uhr ND-Foto: Burkhard Lange
Die gegenwärtig unterm Berliner Fernsehturm in einer einmaligen Schau gezeigten Uhren aus Glashütte haben eine lange Geschichte. Diese Geschichte hat zwei Anfänge, aber dafür kein Ende. Noch nicht. Der erste Anfang: Im Dezember 1845 erhielt der Hofuhrmacher Ferdinand Adolf Lange von der sächsischen Landesregierung den Auftrag, durch Gründung von Uhrenunternehmen der unterentwickelten und notleidenden Stadt Glashütte zum wirtschaftlichen Aufschwung zu verhelfen. Der zweite: In Dresden werden auf Initiative der städtischen Sparkasse zwecks Spende für den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerbombten Frauenkirche Armbanduhren mit einem Sandstein der Ruine verkauft. Die Uhr wird in Weimar montiert, die Einzelteile, bis auf den Stein natürlich, stammen aus Pfortzheim.
Glashütte liegt 28 km entfernt von Dresden im Osterzgebirge. Uhren werden in dem einst staatlich organisierten industriellen Standort mit 3 500 Seelen noch immer produziert. Einmalige sogar Der einstige VEB Glashütter Uhrenwerke, heue Glashütter Uhrenbetrieb GmbH (GUB) ist in der EU einziger Produzent mechanischer Uhrwerke. Nur die Schweiz kann das noch. Auch zu Spitzenzeiten des Quarzes, als die DDR millionenfach Glashütter Armbanduhren unter dem Pseudonym „Meister-Anker“ an bundesdeutsche Versandund Warenhäuser lieferte, war die Mechanik nie ganz aufgegeben worden. So erhielten sich uhrmacherische Kompetenz und eine sonst in Deutschland ausgestorbene Tradition.
Das und vielleicht das allgemein erwachte Interesse an den tickenden Zeitmessern müssen die Treuhand veranlaßt haben, nach der ersten mißglückten Privatisierung durch den französischen Rohwerkehersteller France Ebauches, den Betrieb samt Schulden zurücknehmen und einem
neuen Sanierungskonzept, das auf Klasse statt Masse setzt, Stimme und Geld zu geben.
Für die verbliebenen 100 von einst 2 000 VEB-Mitarbeitern jedoch schien Mitte 1993 die Uhr stehenzubleiben. Aber ein fünfter Sanierer kam und mit ihm die sechste Entlassungswelle. Im Herbst werden noch 73 GmbH-Arbeitnehmer übrig sein (und 45 Lehrlinge, die mit Hilfe der Treuhand ihre Ausbildung beenden können). „Das ist die äußerste Grenze, tiefer geht's nicht“, sagt der gekündigte Betriebsratsvorsitzende Lutz Sommerschuh, „sonst wird es nur noch eine Vertriebsfirma. Aber wir wollen ja hier in Glashütte die Tradition des Uhrmacherhandwerkes, also nicht nur das Zusammensetzen, Einschalen und den Verkauf einer Uhr, sondern auch die Herstellung des Uhrwerks selbst erhalten.“ Der gelernte Feinmechaniker hat dem Interessenausgleich der Vorstufe eines Sozialplanes - zugestimmt. Er weiß, daß es nicht nur um die verbleibenden 73 geht, sondern um die ganze Region. Trotz schlechter
Erfahrung wünscht er sich eine schnelle Privatisierung. Den Kollegen ginge sonst die Luft aus.
Eberhard Wagemann - der fünfte Sanierer und seit Februar Geschäftsführer von GUB - sieht das verhaltener Noch ein Fiasko würde Glashütte nicht überleben. Für den Berliner Steuer- und Unternehmensberater und Privatisierer verschiedener hauptstädtischer Einrichtungen (z.B. des Fernsehturms) läuft die Uhr Ende '94 ab. Bis dahin muß er verkauft und zeitgleich saniert haben. „Also Konzen-
tration auf das Wesentliche“, sagt er - und meint damit die „Glashütte Original“ Das neue mechanische Uhrwerk - eine Nachwendeentwicklung für 2,5 Millionen Mark - war in 40 000 Werkstattstunden entstanden und geblieben, als die Franzosen gingen.
Die deutsche Automatikherrenarmbanduhr hatte in Glashütte zu ticken begonnen. „Wir haben hier die einzigartige Chance, wieder eine deutsche Uhr auf dem höherwertigen Markt zu positionieren“, hofft Eberhard Wagemann, an einem Arm die Glashütter, am
anderen die Schwanitzer „Wir sind hier letztendlich ein bißchen deutsches Kulturgut“, schwärmt er, der bis dato noch nie etwas von Glashütte gehört hatte, „einer der wenigen Luxuskonsumartikel aus den neuen Bundesländern.“ Der Luxuskonsumartikel tickt nun schon in 3 500 deutschen Fachgeschäften, in Österreich, Asien und Osteuropa.
Das Schmuckstück wird traditionell und aus Qualitätsgründen mit Lupe, Pinzette und Schraubenzieher montiert. Es kommt klassisch, elegant oder auch sportlich daher, je nach Geschmack und Geldbeutel in Edelmetall, Platin oder auch Gold. Luxus hat seinen Preis: Zwischen 550 und 8 000 Mark liegt der Letztendlich aber, im Verhältnis zum gestiegenen Einkommen, nicht höher als zu DDR-Zeiten. Soweit man Einkommen hat.
7,5 Millionen Mark Umsatz hat sich der Betrieb für 1994 vorgenommen. Mindestens 10 Millionen müssen es werden, um schwarze Zahlen zu schreiben. Einem neuen Eigner wird sicherlich die Treuhand unter die Arme greifen. Aber, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ein Uhrenbetrieb keinen industriellen Standort.
Momentan scheint Glashütte das, was es zu Ferdinand Adolf Langes Zeiten einst war. Sollten sich“die sächsischen Landesherren nicht guter alter Tradition ihrer Amtsvorgänger erinnern? So ließe sich vielleicht gar eine Lösung für das Uhrenmuseum finden. Noch wollte es keiner haben, und im Herbst laufen die ABM-Stellen der beiden Mitarbeiter aus.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.