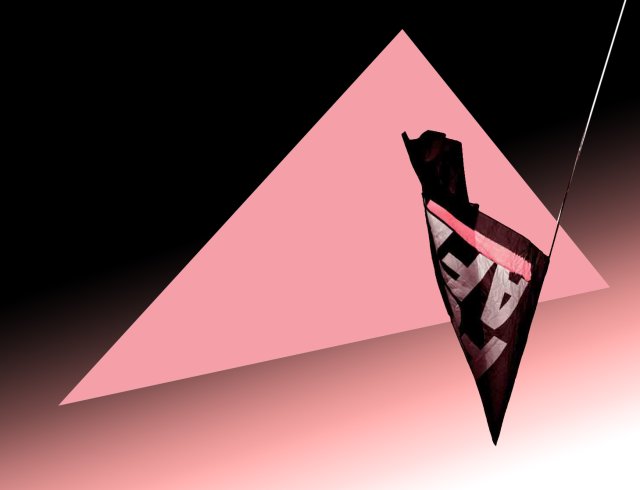»Ich frag mich doch nicht, warum ich lebe«
Matthias Vernaldi fordert vehement das Recht auf Selbstbestimmung ein. Er weiß, wovon er redet - an Muskelschwund erkrankt, ist er vollständig auf Assistenz angewiesen.
Berlin-Neukölln. Eine Ladenwohnung, groß wie ein Tanzsaal. Den schweren Holztisch beiseite geschoben, könnte sich hier eine kleine Dorfgemeinschaft beim Erntefest vergnügen. Riesige Grünpflanzen im Schaufenster, ein Aquarium beherrscht den Raum. Matthias Vernaldi hockt in seinem Rollstuhl, der viel zu wuchtig ist für den schmalen, zerbrechlichen Körper. Ruht immer wieder seinen viel zu schweren Kopf an der Nackenstütze aus. Kluger Blick hinter dem Brillengestell. Die Arme, kraftlose Flügel, vor dem Körper gekreuzt. Überraschend volltönend die Stimme, einer der was zu sagen hat, der weiß, dass man ihm zuhört.
Muskelschwund. Früher glaubte man, dass Trolle den Eltern die schönen und gesunden Kinder stehlen und ihnen Wechselbälger unterschieben, ihre eigenen verkrüppelten Trollkinder mit großen Köpfen, die nur herumgetragen werden wollen, stets greinen und weinen und trotz aller Sorge jung sterben. Die Krankheit kommt heimtückisch daher: Nach und nach kann das scheinbar gesunde, Baby sich nicht mehr aufrichten, wirkt ungeschickt, kann die Gelenke nicht mehr strecken. Der Muskelschwund, der zur Unbeweglichkeit verdammt, schreitet fort, wird die Organe erfassen, das Herz, die Lunge, schon funktioniert die Peristaltik der Verdauung nicht mehr so gut. Mit der Krankheit stirbt man jung. Heißt es. Doch Vernaldi ist 47, ein Methusalem. Kann gerade mal noch einen Finger ein bisschen bewegen.
Totale Abhängigkeit
»Ich bin assistenzsüchtig«, sagt er und lacht etwas schief. Ob in der Nase bohren oder Hintern abwischen, Rad fahren, Blumen pflücken, mit der Faust auf den Tisch hauen, jemanden umarmen - alles, was mit Bewegung zu tun hat, ist Vernaldi versagt. Seine Droge ist fremde Muskelkraft. Eine Sucht, per Definition eine Krankheit, die stets zum Tode führt, ermöglicht sein Leben. Ein Leben in totaler Abhängigkeit. Entzug führt zum Tod. Kann einer, der sich nicht allein bewegen kann, etwas bewegen? Ein bewegtes Leben haben? Die Sprache jedenfalls ist von der Realität der Gesunden bestimmt. »Wie geht's?«, fragen wir einen, der nicht gehen, »Wie sieht's aus?« einen, der nicht sehen kann.
Matthias Vernaldi jedenfalls ist beweglich - auch wenn so ein Rollstuhl kein Porsche ist. »Ich hol dich ab«, bietet er an, als ob er seinen klapprigen VW-Bus selber lenken würde. Der Mann ist ständig auf Achse, engagiert sich in der Behindertenbewegung, ist bei Konzerten, verreist, hat einen großen Freundeskreis, schreibt Bücher, Gedichte. Den Alltag meistert er mit etwa neun Assistenten, die bei ihm angestellt sind. Er ist Arbeitgeber im Rollstuhl, mit allem, was dazu gehört, inklusive Buchhaltung und Abrechnung mit dem Sozialamt. Ständig ist jemand in seiner Nähe, lauert auf den leisesten Zuruf. Und für Vernaldi scheint die Assistenz inzwischen selbstverständlicher Ausdruck seines eigenen Körpergefühls.
Mit sieben steckte man den Jungen nach Gotha ins staatliche Behindertenheim. Gruselig, was Vernaldi in seinem Buch »Dezemberfahrt« beschreibt: Ein riesiger Schlafsaal, in dem morgens einfach die Betten weggeschoben und Schulbänke aufgestellt wurden. Ein Stück Zuhause war das Aquarium, dass ihm der Vater geschenkt hatte. Im Heim wurde strikt getrennt: Krankenschwestern für die körperlichen Bedürfnisse und Lehrer und Erzieher für die Schule. Sieben Betreuer für 70 Kinder. Morgens im Fließbandtakt Hosen runter und Pisspullen angelegt. Er berichtet, wie man ihm die verkürzten Muskeln in einem Gipsbett richten wollte. Eine Tortur. Die Schmerzen hätten ihn nächtelang nicht schlafen lassen. Und von dem Arzt, der den Kindern ein Stück Muskelfleisch für Forschungszwecke aus dem Oberschenkel operierte. Von dem sie ein Foto fanden, auf dem er in Nazi-Uniform zu sehen war.
Die DDR war nichts für Leute mit schweren Behinderungen. Wenn nicht Verwandte die Pflege übernahmen, wurden sie oft direkt nach dem Schulabschluss ins Altenheim gesteckt. In einer solchen Umgebung war die Lebenserwartung nicht hoch: Mehrbettzimmer, manchmal den ganzen Tag nicht aus den Betten raus. »Die Institution gibt vor, wie du zu leben hast«, der Lebensrhythmus wird vom Dienstplan der Schwestern bestimmt - egal ob Früh- oder Spätaufsteher. Für ihn eine Horrorvision. Vernaldi hatte auf so ein Leben keinen Bock.
Und so zogen sie 1978 los, ein bunter Haufen, Behinderte und Nichtbehinderte, um eine Kommune zu gründen. 19 war er da. Die Behinderten sollten ihre Pflegegelder beisteuern, die Nichtbehinderten die Pflege übernehmen, so die Idee. Weil ein Haus nicht so einfach zu finden war, wandte sich die Gruppe an die Kirche. Die war skeptisch. Und stellte nach einigem Hin und Her ein abgewracktes Pfarrhaus in Hartroda zur Verfügung.
Die Kirchenoberen mussten schnell begreifen, dass die Langhaarigen alles andere im Sinn hatten, als den ganzen Tag fromm zu beten. Man feierte Parties, liebte sich, Kinder kamen zur Welt. Bald gab es auch Stress mit der Staatssicherheit. Der Mann im Rollstuhl, inzwischen studierter Theologe, war in den Kreisen der Offenen Arbeit, wo sich widerständige Jugendliche sammelten, bekannt wie ein bunter Hund. Hartroda zog Leute von überallher an. Vernaldi ein Bürgerbewegter? »Wir wollten einfach unseren Spaß haben«, wehrt er ab.
Wichtiger als der Stand der Bewegung wurde es, Selbstbestimmung einzufordern. Private Autonomie. Nicht leicht für einen, über dessen Körper stets andere verfügten. Er habe erst lernen müssen, dass er ein Recht auf seine Bedürfnisse habe, fährt Vernaldi mit ruhiger Stimme fort. Nach Hartroda ist er froh, dass er jetzt den Leuten Geld geben kann, die ihn versorgen. Ein Schritt aus der Abhängigkeit. Dass nicht jede seiner Alltagsverrichtungen am Entgegenkommen seiner Freunde oder einer Partnerin hängt.
Und so ist er Fachmann für persönliche Assistenz geworden. Verhandelt mit dem Senat, sitzt im Landesbehindertenbeirat. Mischt mit im Vorstand von »Ambulante Dienste«, der Assistenz anbietet, und beim »Bündnis für selbst bestimmtes Leben behinderter Menschen«, das sich 1995, als Reaktion auf die Einführung der Pflegeversicherung, gegründet hat. Denn die habe die Pflege in Module aufgeteilt, Versorgung im Akkord, wie am Fließband. In Berlin geht es Schwerbehinderten immerhin besser als anderswo. »Wir haben es geschafft, dass hier weiterhin nach Zeit abgerechnet wird«, sagt Matthias, ganz der Pflegeprofi. »Wenn du mehr als fünf Stunden am Tag Hilfe brauchst, kannst du den Leistungskomplex 32, den wir erfunden haben, in Anspruch nehmen.« Und dabei selbst über die Personal-, Ort-, Zeit-, Anleitungs- und Geldkompetenz verfügen. In Berlin habe es, so fährt Vernaldi fort, immer schon eine starke Krüppelbewegung gegeben. Und der Senat sei deren Belangen gegenüber stets aufgeschlossen gewesen. Immerhin gab es in Westberlin keine Wehrpflicht, also fehlten die Zivis in der Pflege. Für Matthias Vernaldi war diese Situation Mitte der Neunziger ein guter Grund, nach Berlin zu wechseln.
Zum Beispiel Sex
Ihm seien die Neulinge, die Unsicheren immer lieber gewesen als die gestandenen Pfleger. Denn die hätten sich an ihm orientiert, erwartet, dass er ihnen sagt, was sie tun sollen. Weil seine Leute so gut auf seinen Körper eingearbeitet sind, ist er überhaupt noch am Leben. Mit Pflege am Fließband, ständig wechselnden Helfern, wäre er mit seinem Rollstuhl schon lange über den Jordan gerollt. Und er hat gelernt, seinen Impulsen zu folgen. »Ich habe ein besseres Verhältnis zu meinem Körper, als manche übergewichtige Dreißigjährige.« Einer, der sich nicht mal alleine an der Nase kratzen kann, lernt, das Maul aufzumachen, wenn's ihn juckt.
Zum Beispiel Sex. Wie Befriedigung erlangen, wenn man allein lebt und gerade mal noch einen Finger bewegen kann? Matthias Vernaldi ist Pragmatiker. Nachdem seine letzte Beziehung beendet war und damit auch sein Sexualleben brach lag, hat er einen anderen Weg gesucht: den Kontakt zu Prostituierten. »Ich musste mich entscheiden, Sex in der Realität oder weiterhin nur im Kopf zu haben«, sagt er.
Leicht war der Schritt nicht. Als Freier unterwegs zu sein - »als Christ, Linker und als Zoni: Das kann ja nüscht werden«. Durch den Kontakt zu Hydra, einer autonomen Hurenorganisation, kam nach und nach eine Annäherung zustande. Die erste Erfahrung war »schrecklich«, erzählt er offen, Sympathie gehört schon dazu. Und berichtet von seinen Vorurteilen. Über Frauen mit langen, lackierten Fingernägeln zum Beispiel. Über gewalttätige Zuhälter mit Goldkettchen. »Alles Quatsch«, sagt er heute. Berichtet von Zurückweisungen, die er einstecken musste. Klar, eine Prostituierte muss Nein sagen können. Aber ausgerechnet bei ihm? Berichtet aber auch davon, dass es in vielen Puffs mit der Barrierefreiheit hapert - nur vereinzelt richten sich welche bereits auf die neue Kundschaft ein.
Nur verlogene Spießer und geile alte Säcke gehen ins Bordell, oder? Benutzen die Körper von Frauen, die aus Osteuropa verschleppt, von finsteren Luden zur Prostitution gezwungen werden. »Es wird immer so getan, als ob Prostitution automatisch Zwangsprostitution beinhaltet. Doch je liberaler die Verhältnisse sind, um so weniger Zwangsprostitution ist möglich«, regt sich Vernaldi auf. Eine Verbesserung des Bleiberechtes sei das beste Mittel gegen Zwangsprostitution. Sieht er sich selber als geiler alter Sack? »Mitunter«, das habe schon was mit »auf Geilheit reduzierte Wahrnehmung zu tun«, erwidert er freimütig. Doch habe ihm auch hier, seine Behinderung eine Tür geöffnet in eine bislang fremde Welt. Er werde sich stets für die Rechte der Prostituierten einsetzen, fügt er nachdrücklich hinzu.
Um die Sache aus der Schmuddelecke zu holen, gründete Vernaldi die Initiative »Sexybilities«, eine kostenlose Sexualberatung für Behinderte und alle, die mit Behinderten zu tun haben. Wenn Bedarf besteht, werden auch Kontakte zu Prostituierten vermittelt, die über entsprechende Erfahrungen verfügen. Dass Leute, die wie er vom Sozialamt leben, nicht oft ins Bordell kommen, dafür sorgt das schmale Budget. Doch habe Sex sehr viel damit zu tun, was die Leute für sich selber wollen, sagt er. Wie findet jemand einen Partner, der noch weniger wie Ken oder Barbie aussieht als unsereins? Lange Gespräche, man trifft sich zwei bis drei Mal.
So wurde Vernaldi schon wieder bekannt wie ein bunter Hund. Als ein Behinderter, der sich zu seiner Sexualität bekennt und sie offensiv lebt. Als einer, der ohne Scheu auch mal einen heißen Strip hinlegt - wie bei einer legendären Sexybilities-Party, wo eine Tänzerin ihn, der mit Tüchern verhüllt, nackt auf einem Podest lag, entblätterte.
Leben im Hier und Jetzt
Einen Wechselbalg wird man wieder los, wenn man ihn schüttelt, schlägt, misshandelt. Dann kommen die Trolle und machen den Tausch flugs rückgängig, ergänzt Matthias. Auch er kennt die Geschichte. Und seine Kindheit? Bei Vernaldis gab es viel Liebe, Offenheit, Kreativität. Seine Eltern, einfache Leute aus der Saalfelder Ecke, hätten alles aus Gottes Hand genommen, ohne zu hadern. Auch wenn er sich am pietistischen Glauben von Vater und Mutter bis heute reibe: »Wichtig ist, welcher Subtext in der Familie zugrunde liegt, wie über Gefühle geredet wird, was über das Normale, Alltägliche hinaus noch praktiziert wird.«
Langfristige Pläne hat er nie gemacht, lebt im Hier und Jetzt, nimmt einen Tag nach dem anderen. Und die ständige Nähe zum Tod? »Das verdrängt man«, sagt Vernaldi, der sonst so gerne in der ersten Person Singular spricht. »Man will festhalten, will leben«. Andererseits relativiere der Tod vieles, tröste über Schmerzen. »Nur wenn jemand stirbt, den du kennst und den du liebst, kommen das Verdrängte, die Angst wieder hoch.« Kein Grübler, kein Zweifler. Hat nie nach dem Warum für seine Krankheit gefragt. Nur nach dem »Wie«. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers, der Gefühle, des Geistes, das sei eine interessante und manchmal auch befremdende Geschichte, sagt er. Aber das Warum? »Ich frag mich doch auch nicht, warum ich lebe.«
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.