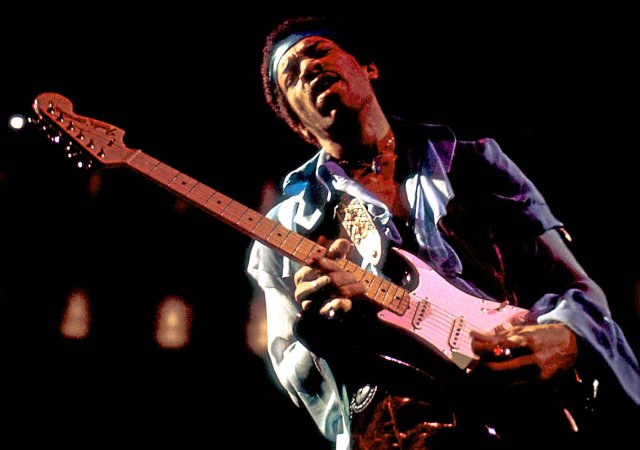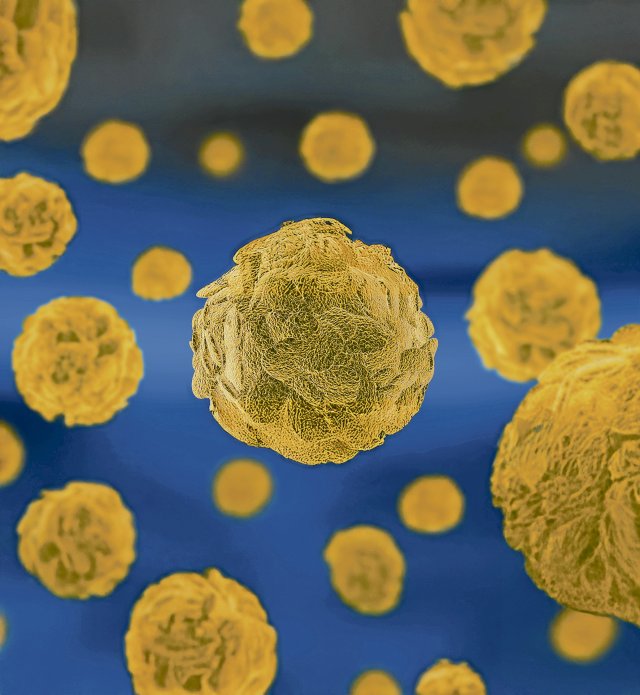Man ist, was man isst
Norwegische Studie über den Einfluss kindlicher Ernährung auf das spätere Verhalten
In Norwegen wird generell jede Schwangerschaft dem Gesundheitsamt gemeldet. Rund 60 000 sind dies pro Jahr. Ein Drittel der werdenden Eltern nimmt an einer Einzel-Studie zur Ernährung teil. Beginnend mit der 22. Schwangerschaftswoche beantworten sie dazu umfassende Fragebögen, die sich besonders mit dem Ess- und Trinkverhalten ihrer Söhne und Töchter befassen. Bei der Auswertung der Antworten fand man heraus, dass das spätere Verhalten eines Kindes - sei es aggressiv oder depressiv - eng mit seiner frühkindlichen Ernährung zusammenhängt.
Der Volksmund hat Recht. »Man ist, was man isst«, bestätigt der klinische Psychologe Eivind Ystrøm von des staatlichen Forschungsinstitutes FHI in Oslo. »Kinder, die früh in ihrem Leben mit ungesunder Ernährung wie Fett und Zucker konfrontiert werden, zeigen mehr problematische emotionale Symptome und sind eher verhaltensauffällig. Verglichen mit anderen Kindern sind sie unaufmerksamer, ihre Erregbarkeit ist erhöht und sie sind deutlich ängstlicher.«
- Das Folkehelseinstituttet (FHI) in Oslo ist direkt dem Ministerium für Gesundheit zugeordnet. Es soll die Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung fördern sowie Krankheiten und Verletzungen vorbeugen. In diesem Rahmen führt es die Kohortenstudie »Mutter und Kind« mit vielen Einzel-Studien durch. www.fhi.no
- Etwa 15 bis 20 Prozent der norwegischen Kindern zeigen mentale Probleme, die sie im Alltag beeinträchtigen. Eine psychiatrische Diagnose haben acht Prozent der Kinder. at
Weitere Befragungen sollen zutage fördern, ob die bisher festgestellten Auffälligkeiten angeboren, angegessen oder möglicherweise erworben sind. Denn weitere Faktoren wie der soziale Status oder auch der Erziehungsstil können ebenso eine Rolle bei der mentalen Gesundheit spielen wie beispielsweise der Familienstand oder die Tatsache, dass die Mutter raucht.
Aber das Ernährungs-Puzzle wird insofern komplexer, als man zuvor herausfand, dass Mütter, die dazu neigen, ihren Kindern eher fette oder zuckerhaltige Produkte aufzutischen, selber emotional instabiler sind. Sie reagieren ängstlicher, trauriger und haben weniger Selbstbewusstsein. Diese Frauen mit niedriger Stress-Schwelle geben bei Hindernissen eher auf und haben das Gefühl, wenig Kontrolle über ihr Kind zu haben.
»Paradoxerweise versuchen sie dies mit verstärkter Kontrolle auszugleichen«, so Eivind Ystrøm. Wechselnde Ge- und Verbote rufen bei den Kindern jedoch verstärkt den Wunsch nach dem Konsum von Süßigkeiten hervor. Und wenn dieser nicht erfüllt wird, reagieren sie mit Wutanfällen. Damit können ihre Mütter schlecht umgehen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.