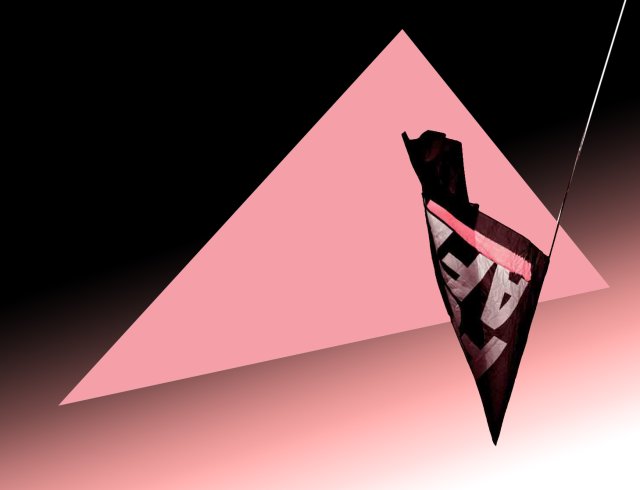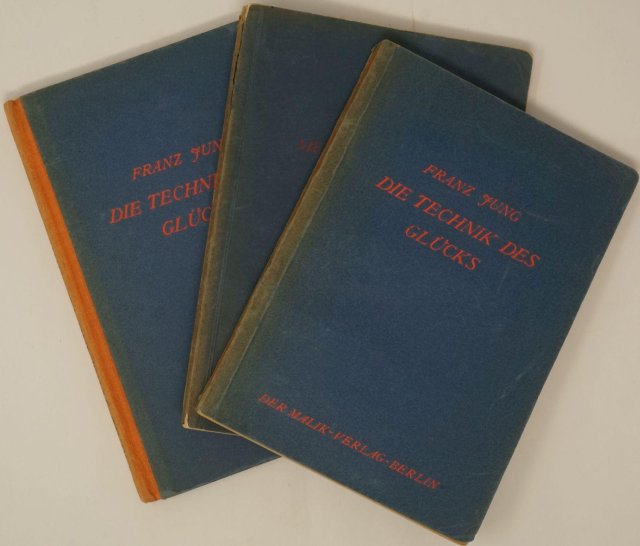»Jetzt will ich es wissen«
Wahlen in Berlin: Senator Thomas Flierl über sein Kulturverständnis und einsame Momente
Flierl: Ob Senator oder nicht - so aufzutreten, wäre generell nicht meine Art. Ich habe mir im Wahlkampf Formate gewählt, die thematisch orientiert sind, Gesprächsrunden, etwa über kulturelle Bildung, über Strategien für den öffentlichen Raum, über die Zukunft der DDR-Vergangenheit.
Kurz: Sie finden Wahlkampf toll.
Toll? Das ist keine Kategorie für mich. Aber angenehm finde ich diese Phase durchaus - weil jene Bindungskräfte, die in einer Koalition immer wieder zu beträchtlicher Disziplin anhalten, plötzlich aufgehoben sind. Man kann eine klarere Sprache sprechen, darf kompromissfreier formulieren. Natürlich fragt man sich, wie so ein Wahlkampf das politische Meinungsbild einer Stadt wie Berlin wirklich verändern kann.
Die Antwort?
Auf der einen Seite glaubt man's, andererseits zweifelt man.
Skepsis und Glauben - zwei Tugenden, die einander auszuschließen scheinen.
Und die doch beide sehr gut in einer Seele Platz haben.
Worin läge der Verlust für Berlin, wenn Sie nicht weiter an der Macht und also nicht wieder Kultursenator würden?
Ich glaube, dass ich Berlin ein etwas anderes Politikverständnis bieten kann.
So eine Art Antiheld?
Im politischen Geschäft empfinde ich mich immer noch als selbstbewusst agierender Gast. Und das keineswegs erfolglos. Wo ich Fehler mache, reflektiere ich das, und zwar öffentlich. So wie Künstler mit ihrer Arbeit immer auch Möglichkeiten und Grenzen ihrer eigenen Kunst befragen, so brauchen wir in der Politik ebenfalls einen Stil der Selbstreflexion, der das eigene Handeln als Versuch und Irrtum öffentlich macht. Wir stehen doch nicht frei über den Prozessen, die wir bewegen oder ordnen.
Also: leidenschaftlich sein und gleichzeitig neben sich stehen?
Ja. Und es heißt, den Mut zu haben, regelverletzend in die landläufigen Politikmechanismen einzugreifen, sperrig zu bleiben - und darauf zu bauen, dass das Sperrige mitunter mehr Vertrauen bei den Wählern schafft als fortwährende Anschmiegsamkeit. Ich fühle mich jedenfalls nicht als der Typus, der seine Ausstrahlung davon ableitet, wie sehr er Sicherheit und Konfliktfreiheit suggerieren kann.
Ist das schon linke Politik?
Es gab in Berlin einen ungeheuerlichen Bankenskandal, es gab den Zusammenbruch einer ganzen politischen Kultur, das frühere System Westberlin ist zerfallen, seine politische Klasse verunsichert. Erst die daraus erwachsende labile Situation schuf den Boden für einen rot-roten Senat. Dessen Geschichte ist also nicht zu erzählen als die Geschichte eines üblichen parlamentarischen Wechsels. Es ist auch eine Geschichte darüber, wie neue Kräfte das Politikfeld betreten, die manchem vielleicht merkwürdig unprofessionell erscheinen, für andere jedoch interessante Anknüpfungspunkte bieten. Dieses Naturell, nicht stromlinienförmig zu sein, irgendwie eckig zu bleiben, das würde ich mir, ohne überheblich sein zu wollen, schon attestieren.
Und andere Offerten?
Ich habe als jemand, der aus dem Osten kommt, gesamtstädtische Politik betrieben. Wir aus der DDR haben ja dem Westen bereits ein Scheitern und eine große Abwicklung voraus, vielleicht erwuchs daraus meine besondere Sensibilität für Konflikte zwischen beiden Teilen der Stadt. Ich glaube, Politik in Berlin braucht genau diese Doppelperspektive, weil sich im Politikgeschäft sonst schnell wieder das Handeln nach jener Standardphrase einpegeln würde, der Ost-und-West-Konflikt sei erledigt.
Was aber nicht stimmt.
Wenn nach der Wende in den Wissenschafts- und Kulturbereichen weniger als zehn Prozent der zu Berufenden aus dem Osten kamen, das heißt, ihr Abitur in der DDR gemacht haben, dann sagt das viel aus über die Reproduktion von Leistungsträgern dieser Gesellschaft.
Lässt sich Ihr Kulturverständnis auf einen Punkt bringen?
Vielleicht ist es eine spezielle Mischung aus klassisch-moderner Kulturbürgerlichkeit und dem Interesse für neuere Avantgarden.
Was bedeutete das für die Koalition mit Sozialdemokraten?
Für unseren politischen Partner sind das Ästhetische und das Soziale mitunter Antipoden, das heißt, wenn man der Stadt soziale Zumutungen auferlegte, dann schien es schlüssig, symbolisch eine Oper zu schließen, quasi ein Opfer darzubringen. Im nächsten Moment aber waren das Soziale und das Ästhetische wieder ganz eine Einheit - ob als etablierte bürgerliche Kultur oder als Soziokultur. Berlin bedeutet aber gerade die Spannung des Ästhetischen und des Sozialen. Ich glaube, wir haben diese Spanne zwischen dem 3- Euro-Ticket und der avancierten Hochkultur ganz gut in den Blick genommen. Berlin ist nicht die ganzheitliche Repräsentation offizieller Kultur; gerade diese Stadt ist die Vielfalt gebrochener Formen, ist steter Wechsel von Grobem und Zartem, Feinem und Ungefügem.
Im Streit um einen neuen Intendanten des Deutschen Theaters - Sie hatten Christoph Hein vorgeschlagen und scheiterten - offenbarte sich, wie sehr man in Ihnen einen DDR-Nostalgiker vermutete.
Was purer Unsinn ist. Aber ich hatte die Heftigkeit des Gegenwindes so nicht erwartet. Eine Stadt muss solche Kämpfe freilich aushalten, ein Senator sowieso. Die öffentliche Debatte zeigte ja nur, was da offenbar bislang verdrängt worden war an ost-westlichen neuralgischen Punkten. Dem Deutschen Theater hat das Ganze jedenfalls nicht geschadet, dem Intendanten Bernd Wilms schon gar nicht.
Haben Sie gezählt, wie oft Ihr Rücktritt gefordert wurde?
Nein. Ich erlebe nur immer wieder, dass ich vorne heftig attackiert werde, und hinter den Kulissen ist längst akzeptiert, was wir anstoßen. So war es bei der Opernreform und auch beim Mauerkonzept. Es gibt in Berlin leider immer noch keine wirkliche politische Streit- und Konsenskultur, sondern hauptsächlich eine Unkultur des Rechthabens und Rechtbehaltens.
Unbestreitbar gibt es eine erkennbare Gruppe von Akteuren dieser Stadt, die das baldige Ende des Kultur- und Wissenschaftssenator Flierl will.
Ja, ich bin zum Hassgegner bestimmter Leute geworden, insbesondere von CDU und FDP und Teilen der Grünen. Das bringt manche Klarstellung mit sich.
Fühlen Sie sich dabei zu jeder Zeit von der eigenen Partei getragen?
Der Linkspartei.PDS bin ich außerordentlich dankbar, dass sie es mit mir aushält und mich in meiner Art akzeptiert und arbeiten lässt. Natürlich gibt es Defizite bei der PDS, zu denen ich zähle, dass viele Menschen aus dem Kulturbereich - auf Grund von Enttäuschungen über das Ende der DDR und auch über Entwicklungen in der PDS - keinen direkten Kontakt mehr zu uns haben. Diesen Kontakt versuche ich wieder herzustellen. Andererseits habe ich mich nie als jemand verstanden, der nur Mitglieder der PDS repräsentiert, sondern vor allem Wählerinnen und Wähler, die von einem breiten Linkspartei-Projekt träumen, von einer kreativen und undogmatisch anspruchsvollen Linken.
Keine Momente, in denen man einsam ist?
Doch. In bestimmten Situationen wünschte ich mir schon mehr Unterstützung aus eigenen Reihen.
Momente, die Sie also gern gestehen.
Ja. Warum nicht. Es gibt in der Berliner PDS zum Beispiel keine kulturpolitischen Arbeitsgremien, wie wir sie im Wissenschaftsbereich mit der Landesarbeitsgemeinschaft haben. Das schafft Risiken, weil mir so im Amt mitunter ein wichtiges Korrektiv fehlt.
Ist denn das Wort »Bürgerlichkeit«, das Sie vorhin verwendeten, noch immer ein Reizwort in der PDS?
Ich befürchte es. In der deutschen Geschichte gehörte die Linke nicht zur bürgerlichen Gesellschaft, weil sie diese entweder überwinden wollte oder weil sie selber, durch die Konterrevolution, aus dieser bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen wurde. Dieses Dilemma der Linken in Deutschland muss endlich überwunden werden. Die Linke muss kulturell und politisch-habituell im weitesten Sinne Teil der bürgerlichen Gesellschaft sein, muss sich zu dieser bürgerlichen Gesellschaft bekennen.
Und sie transformieren?
Nicht die bürgerliche Gesellschaft, sondern den Kapitalismus. Wir haben fälschlicherweise immer die bürgerliche Gesellschaft mit dem Kapitalismus identifiziert und oft genug nicht verstanden, dass die bürgerliche Gesellschaft gegen den Kapitalismus zu verteidigen ist, dass es darum geht, die Kapitaldominanz in der bürgerlichen Gesellschaft zu überwinden.
Wie quält Sie das Spannungsfeld zwischen denen, die sich Kultur leisten können, und denen, die da sozial nicht mehr mitkommen?
Natürlich quält es. Ich leite ein Ressort, das exakt diesen bürgerlichen Kulturbegriff widerspiegelt, also auch: die Verengung auf historisch gewachsene künstlerische Einrichtungen, speziell im einstigen Westberlin. In Berlin-West gab es die Trennung zwischen völlig mangelhaft ausgestatteten Kunstämtern der Bezirke und einer Festspielkultur, die im Grunde die Hauptstadtkonkurrenz beider deutscher Staaten in Berlin-Ost und Berlin-West bediente. Im Osten dagegen existierte, übrigens in guter sozialdemokratischer Tradition, ein kommunaler Kulturbereich, und daneben, zentralistisch geleitet, gab es die großen Kultureinrichtungen. Ein gestaffeltes System. Mit Schmerzen sehe ich heute, was kulturpolitisch kommunal im Argen liegt, aber meine Zuständigkeit endet an den Bezirksgrenzen. Das ist das eigentliche Problem: dass Kulturpolitik anders strukturiert, projektbezogen und ressortübergreifend sein müsste, um ihrer sozialen Funktion gerecht zu werden.
In der Gedenkstätte Hohenschönhausen setzten Sie sich - zumindest - Missverständnissen aus, weil Sie unverschämten Auftritten ehemaliger Stasi-Leute just an diesem Ort nicht entschieden widersprachen. Vor kurzem ging Ihr Mauergedenkkonzept reibungslos über die Bühne. War das für Sie denn eine besondere Genugtuung?
Ja.
Weil Sie damit auf besondere Weise, und zwar unmissverständlich, offen legen konnten, kein Schönfärber politischer Untaten des DDR-Regimes zu sein?
Ja. Ich befinde mich mit diesem Mauergedenkkonzept im Zentrum einer Zumutung, die ich für richtig halte: Die einen, vorwiegend im Westen, stören sich daran, dass ausgerechnet ein PDS-Politiker dieses Projekt vorangebracht hat und verantwortet, und bei den Linken müssen einige damit fertig werden, dass sehr unangenehme Wahrheiten über die DDR ausgesprochen und dargestellt werden. Beides ist mir wichtig.
Trotz allem: Warum wollen Sie sich eine zweite Amtszeit antun?
Kontinuität hat einen Eigenwert. Viele Probleme sind nicht im Zeitrhythmus einer einzigen Legislaturperiode zu lösen. Zum anderen ist freilich klar: Ich muss nicht in dieser Maschine drin sitzen. Ich habe meine Arbeit mit großem Einsatz, extremer Disziplin und Ausdauer getan, oft bis zur Erschöpfung - jetzt will ich es wissen, ob das die Leuten sehen und anerkennen. Aber wenn es anders kommt, kommt es anders. Das sage ich sehr gelassen. Das Leben ist in gewisser Weise ein Spiel, bei dem man auf neue Optionen eingerichtet sein muss, wenn es noch Lust bereiten soll. Jetzt kämpfe ich für ein stärkeres Gewicht meiner Partei in einer Neuauflage von Rot-Rot. Und ansonsten warten wir einfach mal die Wahl ab.
Ist der Kampf um die mögliche Schließung eines der drei Opernhäuser überstanden?
Ich habe die Zuversicht, dass diese Debatte vorbei ist.
Eine Folge der von Ihnen installierten Opernstiftung?
Ja. Die Zusammenfassung der Opern in einer gemeinsamen Struktur war ein wichtiger Schritt. Diese Struktur ist jeweils neuen Bedingungen anzupassen, aber der entscheidende Punkt bleibt, dass Oper auf hohem Standard stattfindet und die Dichte der Berliner Opernlandschaft erhalten bleibt. Wenn wir diesen Reichtum nicht geschützt hätten, wären von Berlin verheerende Signale in die Bundesrepublik ausgegangen.
Herr Flierl, bei Ihrer Geburt ist Ihre Mutter gestorben. Welche Rolle spielt sie in Ihrem Leben?
So lange ich leben werde, habe ich mit dem Umstand umzugehen, dass ich mit meinem jeweiligen Alter die Dauer ihres Verschwindens und ihrer Abwesenheit verkörpere. Dafür gab es lange Zeit in der Familie keine wirkliche Form des Erzählens. Ich suche lebenslang meine Mutter, ich versuche, mir ein Bild von einem Menschen zu machen, der nicht nur für mich wichtig ist, aber gerade für mich nicht verfügbar ist.
Eine Chance, selber freier mit dem Thema Tod umzugehen?
Es wurde mir leichter, zu begreifen: Wir verfügen nicht über das Leben.
Auch um einen Linken macht die Wahrheit keinen Bogen: dass es trotz aller Ratio Kräfte gibt, die wir nicht beherrschen.
Leider gehörte es historisch zur Dummheit der Linken, das nicht akzeptieren zu wollen. Das hat verheerende Konzepte und Energien freigesetzt. Was Sie anführen, ist ja die Frage nach der Demut und des Wissens um die eigene Begrenztheit. Aber diese Einsicht ins Fragmentarische unserer Existenz stachelt doch den schönen Ehrgeiz an, gerade deshalb sinnlich, kräftig, irdisch in der Welt zu sein - einer Welt, deren Gesamtbau Wunder und Geheimnis außerhalb unserer selbst ist.
Interview: Hans-Dieter Schütt
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.