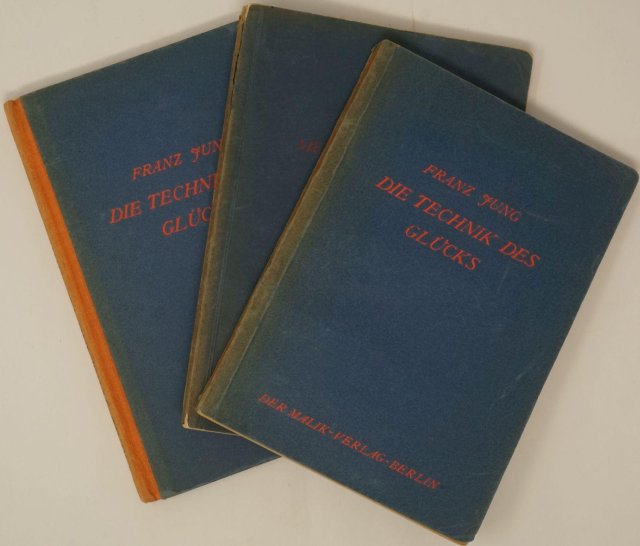Erik allein zu Haus
An der Deutschen Oper in Berlin geht wieder mal ein »Fliegender Holländer« an Land
So düster und so deprimierend wie jetzt in der Deutschen Oper Berlin ist Richard Wagners »Fliegender Holländer« selten zu erleben. Schon klar, dass es nie besonders lustig ist, wenn es so ausgeprägt um Weltflucht geht und um Außenseiter, um fixe Ideen und den praktischen Krämergeist, mit dem ein seefahrender Pfeffersack seine Tochter verschachert - und das auch noch an den Erstbesten, der zufällig neben seinem Kahn vor Anker geht. Dabei ist das Lebensdrama, dass der kreuzbrave Erik trotz Verlobung bei Senta gegen ihren Traummann keine Chance hat, noch am nachvollziehbarsten.
Zum Lachen ist das wirklich nicht. Aber in Berlin verpassen Rufus Didwiszus (Bühne), Emma Ryott (Kostüme) und Christian Spuck (Regie) dem Personal nicht nur dunkle Klamotten, sondern jedem auch noch seine persönliche Depression oder zumindest Lebensschwäche. Selbst der Holländer ist ziemlich wacklig auf den Beinen und geht ein paar Mal zu Boden. Samuel Youn hat neben seiner vitalen Strahlkraft ansonsten einen Leidenston bis an die Grenzen zum Schluchzen parat, was noch durch seine etwas eigenwillige Diktion verstärkt wird. Am schlimmsten aber trifft es Erik, der hier immer auf der Bühne ist, sodass alles, was passiert, Teil seines Lebensalbtraums wird.
Immerhin ist es logisch, dass der auf einen Leidenshabitus festgelegte, dabei sehr schön singende Thomas Blondelle am Ende allein und verzweifelt zurückbleibt. Da in Berlin die Fassung mit dem Erlösungsschluss gespielt wird, bleibt genügend Zeit, damit sich alles Volk verzieht und Erik zu Haus zurückbleibt. Vorher hatte Senta einen ziemlich theatralischen (Liebes-)Selbstmord vor aller Augen hingelegt. Erik hat diesen Suizid - zumindest fahrlässig - mitverschuldet, weil er das Messer, das er ihr schon abgenommen hatte, in der Hand behielt, sodass sie es doch noch gegen sich richten konnte.
Ingela Brimberg ist eine fantastische Senta. Sie überragt mit ihrer klar strahlenden, nie forcierten, wunderbar bis ans Piano geführten Stimme und mit Bühnenpräsenz das gesamte Ensemble. Wobei auch die kraftvolle Ronnita Miller als Mary und Tobias Kehrer als vitaler Daland überzeugten.
Doch ob es deshalb gleich so schwarzgrau duster zugehen muss in diesem diffusen Bühnenraum mit den zwei großen Türen, die wohl eher ins Nichts als ins Freie führen und vor denen die Nebel wallen und immer wieder das Wasser laut auf den Boden plätschert? Gemeint ist sicher das Meer. Konkret scheint der unbestimmte Allzweckraum von einem Dachschaden betroffen, was im Orchesterpiano dann zu deutlichen Zwischengeräuschen führt.
Den Türen verdankt der szenisch ziemlich zähe Abend wenigstens einen der raren Regieeinfälle von Belang. Wenn nämlich des Holländers Geisterchor aus dem Off raunt, dann entsteht plötzlich ein Sog, der Dalands Matrosen, die sich gerade mit ihrem »Steuermann, lass die Wacht« (höchst eindrucksvoll) geschafft haben, gleichsam wegsaugt, so, als würden sie durch eine offene Tür aus einem Flugzeug gezogen.
Und sonst? Im Dunkeln ist halt konventionell munkeln. Die Holländer-Mannen haben Kapuzen und gucken (vermutlich) vor allem finster. Die Matrosen stampfen und wogen hin und her. Die Frauen bedienen ihre Singer-Nähmaschinen, die am Anfang unter einer riesigen Plane verborgen sind. Wenn die wie ein Segel in die Höhe gezogen wird, entfaltet sie sich zu einer Nähstubenkulisse, in der die Nähmaschinen zu einer aufgetürmten Installation mit Personal werden. Bedenkt man die eigentliche Profession des Regisseurs als Choreograf, so war besonders die Bewegungsdynamik der Chöre erstaunlich brav und konventionell.
Auf die Habenseite dieses szenisch enttäuschenden Abends gehört das Orchester der Deutschen Oper unter Leitung seines Generalmusikdirektors Donald Runnicles. Was er aus dem Graben beisteuerte, war schon erstklassig. Es behauptete sein eigenes Charisma und überdeckte gleichwohl nie die Sänger. Der Beifall war recht einhellig, die Regie kam glimpflich davon. Regelrecht gefeiert wurden die Sänger, besonders die außergewöhnliche Senta Ingela Brimberg!
Nächste Vorstellungen: 11., 16. und 20. Mai
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.