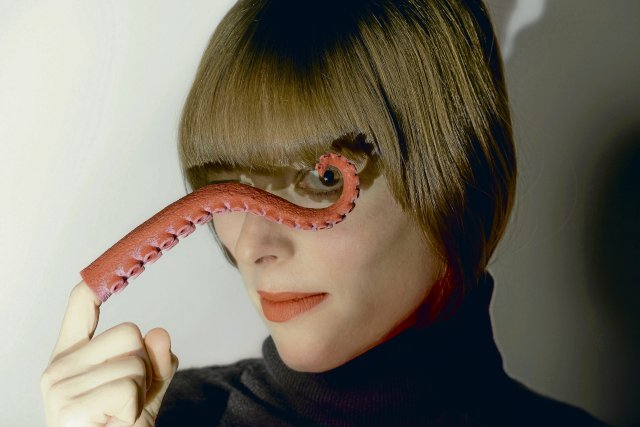Fußball spielende Frauen und Bauarbeiter aus Syrien
Die 9. Alflim in Berlin widmet sich den Widersprüchen in der arabischen Welt
Auf Frauenfußball kommt man nicht auf Anhieb, wenn man an arabische Gesellschaften denkt. Aber warum eigentlich? Denn dass es talentierte arabische Junior-Kickerinnen gibt, beweist einer der Dokumentarfilme auf dem diesjährigen Arabischen Filmfestival Berlin (Alfilm). Zum neunten Mal präsentiert es aktuelles Filmschaffen aus der arabischen Welt, erzählt etwa von ägyptischen, kurdischen oder libanesischen Schicksalen.
Die jordanischen U17-Fußballerinnen aus dem Dokfilm »17« begleitet die Regisseurin Widad Shafakoj mehrere Monate, bevor sie sich in das größte Abenteuer ihres Lebens stürzen: die FIFA U17-Frauenweltmeisterschaft in Jordanien 2016. Die Spielerinnen stammen aus sehr unterschiedlichen sozialen und weltanschaulichen Milieus, einige tragen Kopftuch, andere nicht. Interessanterweise klagen die wenigsten über Kritik von Männern. Eine Kickerin hat sogar in der Jungenmannschaft trainiert und posiert entspannt vor der Kamera mit ihren sie unterstützenden männlichen Kollegen.
Behutsam nähert sich die Regisseurin ihren Protagonistinnen, stellt niemanden bloß. So spielt sich der Alltag der Fußballerinnen aus dem Nahen Osten klassisch zwischen Rasen, Trainingscamp und Mannschaftsbus ab. Nicht jede schafft es allerdings in die finale Auswahl, auch wenn ein Fußball-Vati den englischen Trainer lautstark wegen der Nichtberücksichtigung seiner Tochter beschimpft.
Fußball ist die zweitschönste Sache der Welt, aber existenziell sind eher Dinge wie Arbeit und Familie. So gerät das frisch vermählte Paar Abdelkader und Malika in dem marokkanischen Spielfilm »Volubilis« (Regie: Faouzi Bensaïdi) in ernsthafte Nöte, als Abdelkader seinen Job als Wachmann in einem Einkaufszentrum von Meknès verliert. Der Ehemann hat nach seinem Verständnis versagt: Er kann seine Familie nicht mehr ernähren und muss auch seinen Traum von einer eigenen Bleibe begraben. Denn in »Volubilis« geht es in erster Linie um Haben und Nichthaben, um prekäre Verhältnisse und zur Schau gestellten Reichtum.
Reiche werden im Alltag bevorzugt und setzen ihre Privilegien mitunter brutal durch. So beleuchtet der Film, der allerdings ab der Hälfte arg ins Überdramatische abkippt, wie ein ehrlicher Mann in eine Spirale von Gewalt gerät. Ein von westlichen Zuschauern wohl als übersteigert empfundenes Ehrgefühl spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Ehre können sich die syrischen Bauarbeiter in dem preisgekrönten Dokfilm »The Taste of Cement« (Regie: Ziad Khartoum) nicht leisten. Sie sind Flüchtlinge, bauen ein Hochhaus in Libanon, einem Land, in dem die Einschusslöcher alter Häuserfassaden vom vergangenen Bürgerkrieg zeugen. Daneben entsteht Neues, Spuren- und Geschichtsverwischendes, geschaffen von Menschen, deren Heimat gerade vernichtet wird.
In ästhetischen Bildern dokumentiert der Film Arbeitsabläufe, filmt Beirut, die Stadt am Meer, von oben. Am Ende der langen Schicht geht es für die Arbeiter dann per Lift nach unten, in den Keller, wo sie wie in Fritz Langs »Metropolis« ein freudloses Leben im Untergrund führen, weil für sie eine abendliche Ausgangssperre gilt.
Bis 18. April in verschiedenen Berliner Kinos. www.alfilm.de
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.