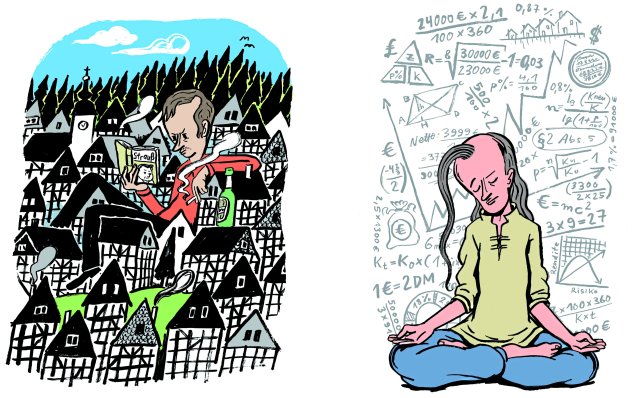- Kultur
- Janelle Monáe
Schmutzig und stolz
Ehemals perfekter Cyborg, singt Janelle Monáe heute für die Freiheit der Verkannten.
Zielstrebige Paukenschläge, majestätisch aufspielende Trompeten in reinstem C-Dur - was im Original von Richard Strauss vertont, wie sich Denker Zarathustra entschließt, zu den Menschen hinabzusteigen, hat nun eine Afroamerikanerin in der Columbiahalle angekündigt; gerade monumental genug für jene Frau, die mit ihrer Musik die Spielräume zwischen Individualität und Konformität auslotet: Janelle Monáe.
Seit »Metropolis«, ihrem ersten Werk auf einem Major-Label, feiern Kritiker*innen die Sängerin dafür, alles ganz eigen und somit nichts falsch zu machen. Statt Charts-konforme Hits zu produzieren, hat Monáe 2007 auf ihrem Debüt eine Klangwelt erschaffen, deren schwelgerische Passagen klassischer Musik an die Filmmusik des alten Hollywood erinnerten. Statt den sexistischen Schönheitsidealen zu folgen, die die Medienwelt für erfolgreiche schwarze Frauen bereithält, trug sie lange nur Smokings und androgyne Outfits. Und statt so zu tun, als sei sie der Nabel der Welt, lenkte Janelle Monáe Robinson die Aufmerksamkeit auf Cindi Mayweather, ihr Alter Ego in Androidenform. Ähnlich wie Zarathustra kommt der Menschmaschine eine messianische Rolle zu: Nachdem sich Mayweather in einen Menschen verliebt hat und vor künstlichen Intelligenzen fliehen muss, reist sie durch die Zeit, um die Androiden von der Unterdrückung zu befreien.
In Zeiten, wo Rihanna unterm Regenschirm grüßte und Katy Perry die Partyqualitäten kalifornischer »Gurls« besang, stellten Monáes dystopische Konzeptalben eine frische Abwechslung dar. Vor allem war das aber keine Automatenmusik, sondern tief in der Popgeschichte wurzelnder, der Zukunft entgegenstrebender R ’n’ B. Monáe klang so belebend wie das Kollektiv Parliament-Funkadelic, so eklektisch wie Prince, so ätherisch wie Erykah Badu und so glamourös wie Outkast. Dass Letztere, genauer der Rapper Big Boi, zu Monáes frühesten Förderern zählte und auch Prince bis zu seinem Tod ihr Mentor war, sagt eigentlich alles.
Noch bis 2013, auf ihrem dritten Album »The Electric Lady«, hat Monáe den rebellischen Cyborg gegeben, mit »Q.U.E.E.N« - ein Akronym für »Queer, Untouchables, Emigrants, Excommunicated, Negroid« - eine Hymne auf die Verkannten geschrieben und sich in Schweigen gehüllt, was Persönliches betraf. Mit Statements wie »Ich date nur Androiden« hat sie sich den Personenkult vom Leib gehalten. Was blieb, war abgespacte Perfektion, unantastbare Fiktion.
Heute bezeichnet Janelle Monáe ihr afro-futuristisch aufgeladenes Sci-Fi-Projekt als »Überkompensation«. Wo Cindi Maywea-ther unerschrocken war, zweifelte die Frau dahinter an der Möglichkeit, den Idealen des Showgeschäfts gerecht zu werden, wenn sie sich als das zeigt, was sie ist: die Tochter einer Hauswärterin und eines Müllmanns, aufgewachsen in der tiefreligiösen Baptistengemeinschaft von Kansas-City. Keine Cyberspace-Jeanne-d’Arc, allenfalls ein virusinfizierter Computer.
Während einer Therapie, die sie noch vor Veröffentlichung ihres zweiten Albums »The ArchAndroid« begann, hat Janelle Monáe Robinson aber zu einem neuen Selbstbild gefunden. In der Dokumentation »A Revolution Of Love« zeigt sie sich dankbar für ihre Erziehung, die ihren Gemeinschaftssinn schärfte: »Meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater haben viel für mich geopfert - ich weiß gar nicht, wie man nicht hart arbeitet.« Auch ihr Hang zu Uniformen entpuppt sich als Verneigung vor dem Arbeitsethos ihrer Eltern.
Unnötig zu sagen, dass die heute 33-Jährige so viel mehr ist als ihre Herkunft. Monáe absolvierte Schauspielausbildungen in New York City und Philadelphia und hat inzwischen auch die Filmwelt erobert, wobei sie Wert auf starke Frauenfiguren legt, wie etwa in »Moonlight«. Es kursiert eine Anekdote aus der Kindheit der talentierten Performerin, sie geht so: Die kleine Janelle musste teils aus der Kirche eskortiert werden, weil sie nicht aufhören wollte, Michael Jacksons »Beat It« zu schmettern. Schon in der Schule war sie der Star der Theatergruppe, ihre Auftritte probte sie im heimischen Keller, Mama Janet kommentierte vom Sofa aus. Mit 16 zog sie nach Atlanta, wo sie in ihrer Freizeit vor der Bücherei sang. Fanpost beantwortete sie während ihrer Schichten in einem Bürofachhandel. Dass ihr Chef sie daraufhin kündigte, war Glück im Unglück. Der Rauswurf inspirierte Janelle Monáe - sie schrieb »Letting Go«, den Song, der Rapper Big Boi auf sie aufmerksam machte und so ihre Karriere lostrat.
In der Columbiahalle brilliert Janelle Monáe, lässt ihre Mimik sprechen, blickt mit großen Augen nach rechts und links, trippelt von hier nach da wie umhergeschubst von unsichtbaren Kräften, macht den Moonwalk und wirft sich, den brillantenbesetzten Mikrofonständer mitreißend, zu Boden. Sie beschwört die tanzende Menge, in die Knie zu gehen, bis sie schließlich selbst hinabsteigt, um den Call-and-Response-Teil von Angesicht zu Angesicht zu singen. Und Monáe, die sich inzwischen als pansexuell identifiziert, spricht: von dunklen Zeiten und Selbstakzeptanz, Feminismus und LGBTQIA*-Rechten - und davon, dass Donald Trump seines Amtes enthoben gehört.
Denn Janelle Monáe hat sich auf ihrem jüngsten Album »Dirty Computer« ihrer Superheldin-Version entledigt. Keine einfache Sache, wie die Sängerin erzählt. Aber der einzige Weg, mit der Angst und Sorge umzugehen, die die Wahl Trumps in ihr auslöste. Der »bug« im System, wie sie ihre persönliche Eigenart einst erlebte, ist seither nicht mehr Schwäche, sondern Superkraft, in der Zeile »I’m dirty, I’m proud« hat sie sie verewigt. Schon auf dem Women’s March in Washington hielt sie die Anwesenden dazu an, all das zu feiern, was sie unterscheide - auch wenn es den Rest verunsichert. »Auch, wenn es euch selbst verunsichert«, fügt sie in der Columbiahalle hinzu. Aber: »Ich bin glücklich, dass ich meine Ängste nicht zwischen mich und meine Freiheit habe kommen lassen«, sagt sie, während auf der Leinwand hinter ihr Trayvon Martin und Martin Luther King erscheinen. Vielleicht ist sie nicht nur die Reinkarnation von Prince, wie manche sagen, sondern auch von Zarathus-tra. Also sprach Janelle Monáe.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.