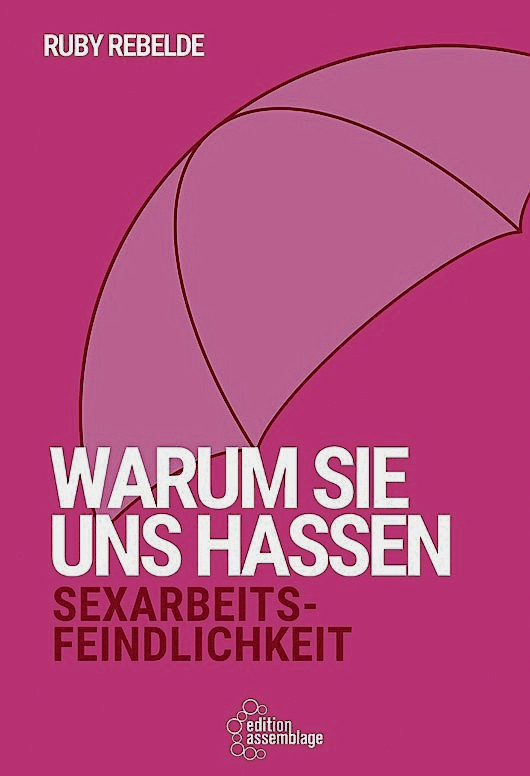- Kultur
- Prostitution
Sexarbeit: Warum sie uns hassen
Was »Schutz« von Sexarbeitenden vorgibt, ist mit Vorsicht zu genießen

Die »Kritik« an Sexarbeit ist eine Position, die seit jeher von der politischen Rechten vehement vertreten wird. Aber wer genau versammelt sich heute hinter dem Slogan »Welt ohne Prostitution«?
Innerhalb der Anti-Sexarbeits-Allianzen lassen sich sechs Cluster oder Strömungen ausmachen. Neben Bündnissen, Kampagnen und Debattenbeiträgen sind diese beteiligten Personen aber auch durch gemeinsame Feindschaften verbunden. Seit 2022 erfasse ich im Rahmen einer Recherche mehr als 250 sexarbeitsfeindliche Akteur*innen, systematisch geordnet nach folgenden Kategorien: weißer Feminismus und Frauenrechtler*innen, rechte Christ*innen, Evangelikale und Freikirchen im Kontext des christlichen Fundamentalismus, ultra-konservative Gruppen, Vertreter*innen der »Gender- und Prostitutionskritik«, die sogenannte PorNo-Bewegung sowie sexarbeitsfeindliche Positionen aus dem linken Spektrum.
Darüber hinaus existieren zwei weitere sexarbeitsfeindliche Lager, die bislang zwar noch nicht Teil der organisierten Anti-Sexarbeits-Allianzen sind, die sich jedoch aufeinander zubewegen. Beide Lager nutzen antifeministische Brückenideologien. Zum einen handelt es sich um Akteur*innen aus dem (extrem) rechten Spektrum, die durch Publizistik, Kampagnen und Konferenzen in Erscheinung treten – organisiert etwa durch Vorfeldorganisationen der AfD, bestimmte Verlage oder Einzelpersonen. Zum anderen, als zweites Lager, gibt es die sogenannte Conspirituality, esoterisch-verschwörungsideologische Gruppierungen und Organisationen. Hier bestehen Verbindungen zur Partei Die Basis, zur Lebensberatungsszene sowie zu fragwürdigen Opferschutz- oder Beratungsstrukturen.
Kulturkampfthema Sexarbeit
Als mich 2023 der Verein Sisters e.V. gemeinsam mit der »Emma« und einer weiteren Organisation abmahnte, erlebte ich immer wieder, dass Leute aus dem Bauch heraus den Zusammenhang von Frauenrechtlertum mit Fundamentalismus, Autoritarismus oder (extrem) rechten Einstellungen nicht begreifen: »Aber das sind doch keine Rechten.« Oder: »Die mögen verbohrt sein, aber ist das gleich rechts?!«
Tatsächlich haben Leute, die so etwas sagen, keinen blassen Schimmer, wie groß das Feld ist, über das ich spreche. Sie haben auch keine Ahnung von Sexarbeit und wieso wir das liebste Hassobjekt der Frauenrechtler*innen sind. Zugegebenermaßen ist die strategisch geführte Öffentlichkeitsarbeit der Allianzen auch einfach sehr erfolgreich. Sie arbeiten vor allem mit folgenden Mitteln: einfache Botschaften, die gezielt zur Emotionalisierung eingesetzt werden, der Anschein zivilgesellschaftlichen Engagements – viele der Mitgliedsorganisationen wirken auf den ersten Blick wie unabhängige Vereine, die ohne eigene Agenda »Gutes« tun sowie De-Kontextualisierung und moralische Aufladung. Hierfür eignet sich Sexarbeit als Kulturkampfthema besonders gut.
So trifft ein sorgfältig kuratiertes Image der Anti-Sexarbeits-Bewegung auf eine politisch orientierungslose Sexarbeitsbewegung, die an der Repräsentation ihrer superdiversen Community scheitert und der es nicht gelingt, sinnvolle Bündnisse zu schließen. Statt nur Vereine, Homepages und Köpfe zu zählen, beschäftige ich mich in meiner Arbeit deshalb auch mit Inhalten: mit antifeministischen, autoritären Ideologien und Einstellungen der Akteur*innen, die in Teilen bestens anschlussfähig mit (extrem) rechten Inhalten sind.
Was mir im Zuge der Recherche ständig begegnet: Reaktionäre Ansichten über Geschlechterrollen, Verehrung autoritärer Figuren wie Trump, konfliktträchtige Gruppen und spiritueller Missbrauch. Immer wieder blitzen Hinweise auf antisemitische und rassistische Theorieversatzstücke auf. Doch nach außen wird ein sauberes Image gepflegt, Schutzhaus nach Schutzhaus eröffnet und leise werkeln diese Kräfte an einer gewaltigen Raumnahme in Wohlfahrt und Diakonie sowie Gleichstellung und Opferschutz. Sexualisierte, rituelle Gewalt ist ein weiteres Binnenthema, das durch alle bereits genannten Gruppen geistert. Zum Teil abstruse Verschwörungserzählungen kursieren, zum Beispiel über angebliche satanistische Eliten, Betroffene von Gewalt werden instrumentalisiert für die eigene politische Sache. Dieser Normalisierungsprozess vollzieht sich auf diesem Feld schon lange und sehr erfolgreich.
Durchaus zweifelhafte Organisationen und Einzelpersonen mit bekannten Verstrickungen ins Verschwörungserzählungs-Spektrum konnten sich bis in hohe Posten hinein etablieren. Sexualisierte Gewalt (noch dazu gegen Kinder) ist ein hochemotionales Tabuthema. Davon wenden sich viele Menschen mit Schaudern ab, schrecken vor einer intensiveren Beschäftigung zurück. So verständlich das ist, überlassen sie damit aber anderen Kräften dieses Feld.
Zudem ist der Sektor Wohlfahrt, Soziale Arbeit und konfessionelle Beratung in meinen Augen aufgrund der eigenen Geschichte und wenig reflektierten Sittlichkeits- und Normalitätsvorstellungen anfällig für solche »Angebote«. Was den Rechten die Freiwillige Feuerwehr oder der Schützenverein ist, sind für rechtsoffene Frauenrechtler*innen und ihre friends aufsuchende Arbeit imitierende Spaziergänge im »Rotlichtmilieu« oder das Mitlaufen bei den jedes Jahr mehr werdenden Walks for Freedom. Neu sind allerdings Konferenzen, wie die 2024 in Erfurt veranstaltete heroica, auf denen vor allem Kulturkampfthemen verhandelt werden. Blieb man vorher eher bei einem Thema unter sich, wie beim Kampf gegen Prostitution, zeigen sich seit einiger Zeit vermehrt Netzwerkeffekte, beispielsweise bezüglich Leihmutterschaft oder Selbstbestimmungsgesetz.
Aggressiv verhandelte gesellschaftliche Triggerthemen wie Schwangerschaftsabbrüche, sexuelle Selbstbestimmung, Familienschutz (auch Schutz von »unseren Frauen und Kindern«) und die »Woke Blase« sind geeignete Sprungbretter für breitenwirksame Kampagnen. Als Experimentierfeld für Kampagnen, Vernetzung und Normalisierung eines extrem scharfen Debattenstils werden Symphatisant*innen über entsprechende Telegram-Gruppen, zum Beispiel lokale RadFem-Kanäle strategisch für Aktionen oder Petitionen mobilisiert. Solche Gruppen waren bisher wenig im Fokus von Recherchen oder Monitoring. Brückenideologien insgesamt waren eher was für antifaschistische Gourmets. Daneben spielen Ressentiments gegenüber Sexarbeitenden eine Rolle. Im Ergebnis hatte lange kaum eine*r einen Überblick, wer da alles zu welchen Themen unterwegs ist. Für die heutige – geeint auftretende, aber durchaus heterogene – Bewegung kann es im Einzelfall helfen, die Motivation für die sexarbeitsfeindliche Positionierung der Strömung zu erfassen.
Ein Wendepunkt in meiner Recherche war die Rekonstruktion des prostitutionskritischen Abolitionismus in der Frauenrechtsbewegung. Dazu musste ich Debatten bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Darauf gebracht haben mich die Anti-Sexarbeits-Bewegten selbst. Hier ist immer wieder die Rede von Josephine Butler oder dem Journalisten Stead. Wie zentral diese Episode sein würde, konnte ich aber damals nicht ahnen.
Lesen Sie auch: Leben mit dem doppelten Stigma – Der Verein Looks bietet in Köln Beratung für trans Prostituierte an. Nikki ist dort regelmäßig, denn niedrigschwellige Unterstützung ist selten.
Autoritäre Sittlichkeitsnormen
Konservative Sexarbeitsfeindlichkeit hat in Deutschland häufig einen Bezug zu Sittlichkeitsvorstellungen und ordnungspolitischer Kontrolle. Registrierungen, Zwangsuntersuchungen, Kasernierungen und ähnliche Verdrängungsbewegungen separieren Sexarbeitende von der Mehrheitsgesellschaft und unterwerfen sie autoritärer staatlicher Überwachung. Damit hängen Ungleichwertigkeitsvorstellungen zusammen, die im Nationalsozialismus zu Verfolgung, Zwangssterilisierung, Inhaftierung und Mord an sexarbeitenden Personen führten. Umso perfider ist der Versuch der Aneignung des Erinnerns und Gedenken an sexarbeitende Opfer von Hass und Menschenfeindlichkeit, der mir in den letzten Jahren immer mal wieder begegnet ist. Nicht einmal davon können sexarbeitsfeindliche Kräfte ihre Finger lassen.
Christlich-fundamentalistische Sexarbeitsfeindlichkeit dagegen handelt im Namen von Rettung und Mission über Schutz der Allgemeinheit vor den Sexarbeiter*innen bis hin zu sexualmoralischen Sittlichkeitsvorstellungen. Am Beispiel von konfessioneller Fürsorge und Wohlfahrt zeigt sich oft, aber nicht immer, ein starker Bezug zum staatlichen Handeln, das auch Wandel und Übergänge der Gesellschaftsordnungen von Faschismus bis BRD/DDR widerspiegelt. Charismatisch-pfingstlerische oder evangelikale Gemeinschaften und ihre »Sozialprojekte« oder Hilfswerke beweisen große Fähigkeiten im Agendasetting. Dabei schleusen sie ihren Wertekanon quasi durch die Hintertür ein.
Diese drei Beispiele zeigen konkrete Herausforderungen, denen ich bei der Recherche begegnete. Historische Kenntnisse ermöglichten mir nach und nach ein besseres Verständnis des heutigen Charakters der Anti-Sexarbeits-Bewegung. Quellen der verschiedenen Strömungen, wie Essays, Konferenzprogramme und Keynotes, lieferten Belege. Darüber hinaus waren mehr als nur rudimentäre Kenntnisse über christlichen Fundamentalismus und rechte Raumnahme erforderlich, um lokale Praktiken in einen größeren strategischen Kontext zu stellen.
In den letzten Jahren durchlebte ich immer wieder Momente von Überforderung und Ekel. Die Beschäftigung tagaus, tagein mit teilweise abstrusen und sehr sexarbeitsfeindlichen Vorstellungen machte etwas mit mir. Es deprimierte, empörte und erschöpfte mich. Ein Teil des Problems war und ist, dass ein Austausch über diese Allianzen aufgrund des bereits geschilderten Desinteresses kaum möglich ist. Self-Care wurde zu einem Drahtseilakt, umso mehr, als Teile der Anti-Sexarbeits-Allianzen mich abmahnten.
Gerade gibt es Momente, in denen ich das erste Mal weniger Isolation erlebe, oder ich bin vielleicht auch einfach resilienter geworden. Es sind mehr Anknüpfungspunkte entstanden, ein paar Menschen mit denen ich mich regelmäßig austausche. Die Recherche ist immer noch groß und weitverzweigt, umso mehr freut mich der Austausch und die Zusammenarbeit zum Beispiel im Recherchekollektiv FundiWatch, an dessen Gründung ich beteiligt war. Vielleicht ergeben sich daraus endlich mehr Synergien?
Weißer Feminismus
Eine der größten Gruppen in der Bewegung für die Welt ohne Prostitution bildeten und bilden Frauenrechtler*innen. Charakteristisch für diesen Weißen Feminismus und das Frauenrechtler*innentum ist bis heute die Verwendung des Abolitionismus-Begriffs und das Postulieren der Abschaffung der Prostitution als Stufe gesellschaftlichen Fortschritts. Im Licht aktueller Debatten um Rassismus, Kolonialismus und Antisemitismus sollte dieses Reframing eigentlich irritieren. (Reframing meint hier die Verwendung des Begriffes, der für die Abschaffung der Sklaverei steht, für die Abschaffung der Prostitution.)
Bereits 1880 existierten Kontroversen darüber – warum macht die Aneignung dieses Begriffs mit all seinen Implikationen heute dagegen so wenige stutzig? Abolitionismus, moderne Sklaverei, Kauf von Körpern oder Frauen – von diesen Begriffen lebt der prostitutionskritische Diskurs. Und zwar nicht erst seit Alice Schwarzer und Sabine Constabel. Auch in den Schriften von Kate Millett oder Rachel Moran werden solche Ausdrücke verwendet und noch weitaus früher. Was zunächst wie eine Petitesse wirkt, ist folgenreich. Statt einer stilistischen Präferenz handelt es sich um einen Spin, es verändert komplett, wie die Zusammenhänge aufgefasst werden. Ausdrücke wie Sklaverei, Abolitionismus oder Frauenkauf verhindern aktiv die erforderliche Differenzierung zwischen sexueller Lohnarbeit und Gewalt. Der zentrale Slogan der Bewegung: Prostitution ist Gewalt übernimmt genau diese Verdrehung.
Wie relevant das für die heutige Lage ist, zeigt sich anhand einer zentralen Figur der deutschen Frauenrechtler*innen: Alice Schwarzer. Schwarzer verfasste seit den 1980ern prostitutionskritische Texte, in denen genau diese Ausdrucksweise verwendet wird. Darin vertritt sie darüber hinaus den Standpunkt, »der Kampf gegen die Prostitution – der nur auf den ersten Blick paradoxerweise gleichzeitig ein Kampf für die Prostituierten ist – ist Hauptschlachtfeld des Frauenkampfes«. Diese Äußerung entstammt dem Text »Für Prostituierte – gegen Prostitution!« verfasst 1981 als Vorwort zur deutschen Ausgabe von Kate Milletts 1971 in den USA erschienenen Buch »Das verkaufte Geschlecht«. Als Quelle für Schwarzers prostitutionskritische Einstellung ist dieser Text aufschlussreich, auch im Hinblick auf die Radikalisierung ihrer Position ab 2013. Er verdeutlicht, wie aus Schwarzers Kampf gegen Prostitution – Spoiler-Alert! – im Laufe der Jahrzehnte der Kampf gegen Prostituierte werden konnte.
»Für Prostituierte – gegen Prostitution!« formuliert einige zentrale Elemente und rhetorische Figuren, unter anderem die untrennbare Verknüpfung von Prostitution mit Macht und Machtmissbrauch: Prostitution sei »Zerrspiegel und Endprodukt einer Sexualität, in der es nicht um Liebe geht, sondern um Macht«. In der Sexualität, so erklärt Schwarzer weiter, seien »Erniedrigung, Scham und Unterwerfung von Frauen verankert«. So pauschal und eindimensional formuliert – so einfach ist es längst nicht. Jenseits von geschlechtlicher Identität existieren vielfältige Kategorien von Andersmachung und Ausgrenzung: Schlechterstellung aufgrund von sozialer Herkunft, Rassismus oder Antisemitismus wirken sich ebenso auf Verlangen, Begehren und persönliche Beziehungen aus. Diskriminierung strukturiert Gesellschaften durch die ungleiche Verteilung von Macht, Einflusssphären und Anerkennung. Obwohl vieles in Schwarzers Texten sich um Macht dreht, definiert sie fast nie, was sie konkret unter »Macht« versteht. Bestimmte Schlagworte wabern also durch den Raum, letzten Endes kaum mehr als Behauptungen ohne Zusammenhang oder Quellen. So macht Schwarzer das seit Jahrzehnten.
Uns zugehört haben sie noch nie!
Schwarzer ermutigte 1981 immerhin noch zum Gespräch mit Prostituierten. 1988 führte sie dann selbst eines mit Domenica Niehoff, einer über Hamburg hinaus bekannten Hure. Dieses Interview ist in einer langen Version auch im 2014 erschienen Buch »Prostitution. Ein deutscher Skandal« enthalten. Die frühen Texte Schwarzers zu Prostitution sind im Ton anders, teilweise moderater als Schwarzer heute spricht. Der »Appell gegen Prostitution« markiert dabei eine Zäsur; wie genau es zu diesem Sinneswandel kam, müsste Alice Schwarzer letztlich selbst beantworten.
Ich vermute folgendes: Der oben zitierte Text erschien 1981 – also nur sechs Jahre nach der Besetzung einer Kirche in Lyon am 2. Juni 1975 durch rund 150 Sexarbeiter*innen. Schwarzer erwähnt darin das 1980 entstandene Café Hydra wohlwollend. 32 Jahre später bezeichnet sie in ihrem Buch »Prostitution – ein deutscher Skandal« die aus dem Café entstandene Beratungsstelle als Prostitutionslobby. Bereits 1981 zeichnet sich aber eine Haltung der Bevormundung und Diskurshoheit ab, die eine spätere Radikalisierung bereits vorwegnimmt. So diktiert Schwarzer den Prostituierten bereits damals, worauf sie zu verzichten haben: »Wir haben zwar noch gegen viel krasses soziales Unrecht zu kämpfen, aber nicht selten kaschiert mehr Geld nur die Entfremdung und Würdelosigkeit der Natur der zu leistenden Arbeit.«
Schwarzers Verständnis von Macht ist moralisch (würdelos) – die Schuldumkehr, Sexarbeiter*innen seien eigentlich Täter*innen, klingt bereits an. Würde ist aber doch ein Privileg, eine Kategorie, die sich vielen von Armut betroffenen Personen nicht stellt. Und doch nimmt Schwarzer sie hier in die Verantwortung, indem sie suggeriert, die Würde von allen stünde durch die Existenz der Prostitution auf dem Spiel: »Männer gehen eben nicht zu Prostituierten, weil ›ihre‹ Frau nicht will und/oder sie keine andere Frau kriegen können. Männer gehen zu Prostituierten, weil sie bei ihnen etwas suchen, was sie bei der Nicht-Prostituierten in dieser Konzentration nicht bekommen: die totale Verfügbarkeit und das totale Gefühl der Macht.«
Wenn Schwarzer von »Spaltungsmanövern« spricht, in das die Frauen vom Patriarchat gehetzt worden seien, wird diese Komponente noch deutlicher: Diese Feststellung scheint zu rechtfertigen, nun selbst zu hetzen und anzugreifen. In der folgenden Passage kommt Schwarzer dann auf den Punkt: »Um so erstaunlicher ist es, daß neuerdings aus frauenbewegten Kreisen Texte auftauchen, die all diese doch längst errungenen Erkenntnisse vernachlässigen und die Frauenfrage auf die Geldfrage reduzieren – und damit zurückfallen auf eine längst überwunden geglaubte platt-materialistische Ebene, die die sozialen und psychologischen Dimensionen von Abhängigkeit und Herrschaft nicht erfaßt. Sicher, es stimmt: immerhin bekommt die Prostituierte Geld für das, was so manche Ehefrau/Freundin ebenso wider Willen, aber dennoch umsonst tut. Sicher, es stimmt: gerade Frauen können Geld nur allzu gut gebrauchen. Doch was ist der Preis für die Prostitution?«
Exklusive Solidarität
Die Frage der Prekarität von Sexarbeit darf Schwarzer zufolge nicht auf Kosten von allen Frauen geklärt werden. Wer das Geld gebrauchen kann und wer darauf zu Gunsten »aller Frauen« zu verzichten hat, darüber möchte Schwarzer gern selbst entscheiden. Sie schiebt damit die Verantwortung für die sozialen und psychologischen Dimensionen den Sexarbeitenden zu. Sie verkaufen ihrer Ansicht nach die Würde aller Frauen. Ihr kommt gar nicht in den Sinn, dass es nicht um »platt-materialistische« Kategorien geht, sondern darum, ein plausibles und komplexes Verständnis von Macht zu entwickeln.
Mithilfe dieser Argumentation verwirft Alice Schwarzer unseren berechtigten Anspruch auf Nichtdiskriminierung, ökonomische Teilhabe und Emanzipation; schon ihr früher Text über Prostitution enthält rechte Talking Points, die bis heute zentral für die Debatte sind. Das Konzept von Menschenwürde und Würdelosigkeit ist bis heute präsent in ihren Veröffentlichungen und Äußerungen zu Sexarbeit. Würdelosigkeit aufgrund von Rassismus und Klimakrise hingegen blenden sie und andere bis heute selbstgefällig aus. Wenn Schwarzer, damals wie heute, von Sexarbeiter*innen fordert: »Kein Brot ohne Rosen!«, heißt das mit anderen Worten: Brot soll es für solche wie uns nur geben, wenn wir uns ihrem lückenhaften Verständnis von Menschenwürde und Macht unterordnen. Es ist eben leichter, nach unten zu treten, als komplexe, gesellschaftliche Zusammenhänge wie Rassismus, Armut und Klimakrise solidarisch in den Blick zu nehmen.
Dieser Artikel ist ein gekürzter und redaktionell bearbeiteter Auszug aus dem dritten Kapitel von »Warum sie uns hassen. Sexarbeitsfeindlichkeit« von Ruby Rebelde, erschienen 2025 in der Edition Assemblage, 429 S., br., 24 €.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.