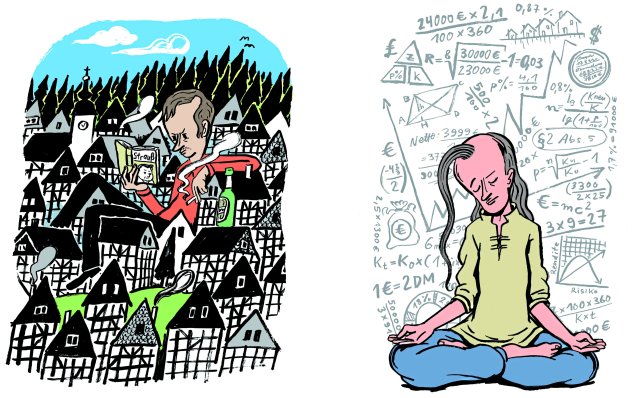- Kultur
- Woche der Kritik
Krise ist immer
»Sich vom Realismus befreien« - geht das? In Berlin ging die »Woche der Kritik« zu Ende

Krise ist immer» - so spöttelten Walter Benjamin und Bertolt Brecht 1936 im skandinavischen Exil und fürchteten sich zugleich vor dem Bedrohungspotenzial des modernen Kapitalismus. Die diesjährige «Woche der Kritik» in Berlin, wie immer ausgerichtet vom Verband der deutschen Filmkritik, prolongierte die alte Losung für’s Heute: Wie kann der deutsche Film auf die gegenwärtigen Krisen reagieren? Und: steckt der deutsche Film selbst nicht auch in einer Krise?
Tapfer und selbstbewusst wie schon in den vergangenen Jahren suchte der Verband nach filmischen Alternativen und nach plausiblen Antworten. Immerhin zeigte er 15 Filme aus ebenso vielen Ländern in einer Woche, parallel zur diesjährigen Berlinale. Und nach jeder Vorführung stellten sich Filmemacher und Filmkritiker öffentlichen Diskussionen. Ergänzt wurde diese Diskursstrecke durch zwei theoriereiche Konferenzen. Jedoch die alte These stimmt immer noch: Wenn ein Film hinterher erklärt werden muss, kann an dem Film etwas nicht stimmen, denn er sollte für sich sprechen. Was er nicht in Bildern zeigt, kann auch nicht erklärt werden. Film ist und bleibt Bildkunst.
Nach einer Arbeitsthese von Verband und «Woche der Kritik» wird ein Film erst durch die sich anschließende Diskussion lebendig. Jedoch: Wer nicht tief in den relevanten Diskursen der Branche drinsteckt, bleibt meist außen vor. So viele Diskutanten - so viele Meinungen, und jeder hat für seine die eigene Begründung. Das bloße filmische Vergnügen, die Lust am Bild und das Erkennen von Lebenssinn in den Bildern, stehen hier explizit nicht im Zentrum. Solch Spannungsfeld kann jedoch durchaus anregend sein und amüsieren.
Weitere Fragen sollten erlaubt sein (und dem Verband ist zu danken, dass er sie öffentlich stellt, auch weil sie sonst in den bundesdeutschen Feuilletons kaum zu lesen sind). Die Veranstalter plädieren für ein randständiges Kino, ein Kino der Grenzüberschreitungen. Folglich erhebt sich die Frage: Wer bezeichnet die Ränder? Wer setzt welche Grenzen? Wie kann der Film weiterhin Projektionsflächen für Utopien anbieten, die die Zuschauer erreichen? Daran schließen sich weitere Fragen an: wie brüchig oder wie stabil ist der Zustand des zeitgenössischen Kinos in Deutschland? Inwiefern kann und soll die deutsche Filmpolitik, also auch die öffentliche Filmförderung, Einfluss auf die entstehenden Filme nehmen? Welche Funktion kann und soll hier die Filmkritik einnehmen?
Corona macht alles noch viel schlimmer. Oder lässt es zumindest schlimmer wirken, denn angesichts der Explosion der Streaming-Dienste, der weltweiten Serienproduktionen und der immer aggressiver werdenden Strategien der Fernsehanstalten war es noch nie so leicht, so viele, so unterschiedliche Filme zu sehen. Und diese enorme Vielfalt lässt dem aufmerksamen, neugierigen Beobachter viel klarer erscheinen, worin Kino tatsächlich bestehen kann.
Die während der Woche gezeigten Filme beantworteten diese Fragen nur sehr bedingt. Alle ausgesuchten Filme vereint, dass sie anders sind als die anderen (oder sein sollen).
Kann beispielsweise eine pure Zustandsbeschreibung soziale oder mentale Relevanz offenlegen? In dem flackrigen Zirkusfilm «Rights of Man» von Juan Rodrigez torkeln vier Amateure, die sich als Zirkusartisten verstehen, durch eine heiße spanische Landschaft, probieren sich in Gymnastik aus, träumen von einer Flucht nach Mexiko. Ja und, fragt man sich hernach. Die vollkommen unpolitische Spielerei ist nicht einmal aufregend fotografiert und bietet keinen Ausweg aus der Beliebigkeit.
Der merkwürdigste und geschlossenste Film, der am radikalsten traditionelle Grenzen überschritt, war «2551.01» des österreichischen Experimentalfilmers Norbert Pfaffenbichler, ein Albtraum in Schwarz-Weiß und ohne Dialoge.
Einen «dystopischen Slapstickfilm» nennt der Regisseur selbst seine giftige Genre-Mischung. Er adaptiert Charly Chaplins Waisenkind-Paraphrase «The Kid» (1920) und assoziiert fintenreich Guantanamo-Szenen und Motive aus Tarkowskis Endspiel-Variante «Stalker» (1979). Ein Mann in einer Affenmaske irrt mit einem Kind, dessen Kopf mit einem zugeschnürten Leinensack verhüllt ist (nur Augen und Mund sind durch kleine Löcher frei), durch ramponierte Kellergewölbe und klaustrophobische Gänge. Sie begegnen einem durchweg anonymen Personal, das sie malträtiert, nur kenntlich als Mumien, Schrumpfköpfe, Puppenmasken, als deformierte Clowns. Dazu viel einfach nur Ekliges. Die beiden verschwinden in einem grauen Irgendwo. Apokalypse als Normalzustand. Der Film hat keine Dialoge, nur Geräusche. Und er offenbart eine enorme szenische Fantasie und geht insofern über alltägliche Kino-Grenzen hinaus.
Noch mehr filmischen Furor bietet der japanische Animationsfilm «Inu-Oh» von Masaaki Yuasa: Wild, geradezu atemlos gestaltet der Film die Entstehung und Wirkung heutiger japanischer Popkultur als siegreiches Ergebnis einer jahrhundertealten Darstellungskultur. Er schöpft zeichnerisch aus den Formen des Kabuki- und Nō-Theaters und lässt kaum eine Komponente der japanischen Mythologie aus. Viel (und laute!) Musik, prächtige Farben, genialisch gezeichnet (obwohl man natürlich weiß, dass das alles computergeneriert wurde).
Dagegen wirkt «Edouard and Charles» (Pascale Bodet, Frankreich) eher bieder und konventionell: Er paraphrasiert die Künstlerfreundschaft zwischen dem avantgardistischen Dichter Charles Baudelaire und dem Maler Édouard Manet, indem er die schmale Story sehr freizügig ins heutige Paris verlegt. Erst gegen Ende wird der Film aufmüpfig, wenn er Bilder des Malers mit deren Karikaturen konfrontiert.
In «Notes for a Déja Vu» montiert das produzierende (anonyme) Colectivo Los Ingrevidos (Mexiko) Schnipsel von folkloristischen Szenen und Demonstrationen in Mexiko, die der berühmte amerikanische Filmavantgardist Jonas Mekas mit seiner Bolex, einer kleinen, sehr handlichen Kamera, 1968 aufgenommen hatte und die er hier mit brüchiger Stimme humorvoll kommentiert. Ein rührendes Zeugnis von Altersweisheit und Kinosouveränität.
Von ähnlicher, sozial grundierter Anmutung zeugte auch der Film «Las Picapedreras» (Azul Aizenberg): der argentinische Filmemacher kompilierte historisches Filmmaterial mit modernen Bildern, um die Streikbewegungen im Lande zu dokumentieren und dabei den großen Anteil von Frauen ins Bild zu kriegen.
Auch die anderen Filme spielen mit den Grenzen zwischen Mythos und Realität, zwischen Utopie und Verlust.
Man weiß es ja - ein Zauber des Kinos besagt: hinter den Bildern liegt die Welt. Das gilt auch weiterhin. Folglich muss die Suche weitergehen. Und müssen weiterhin solche Fragen gestellt werden können, auch wenn es mühsam bleibt, praktikable Antworten zu finden. «Sich vom Realismus befreien» - geht das? Ja, es geht, wenngleich mit Verlusten vor allem für die Zuschauer. Und noch einmal Brecht: «der Vorhang zu und alle Fragen offen».
Von diesem Freitag bis Sonntag, 20. Februar, werden die Filme der Woche im Kino in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte wiederholt.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.