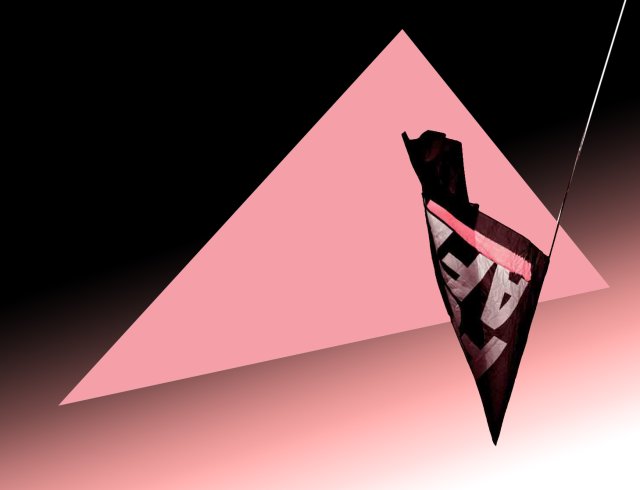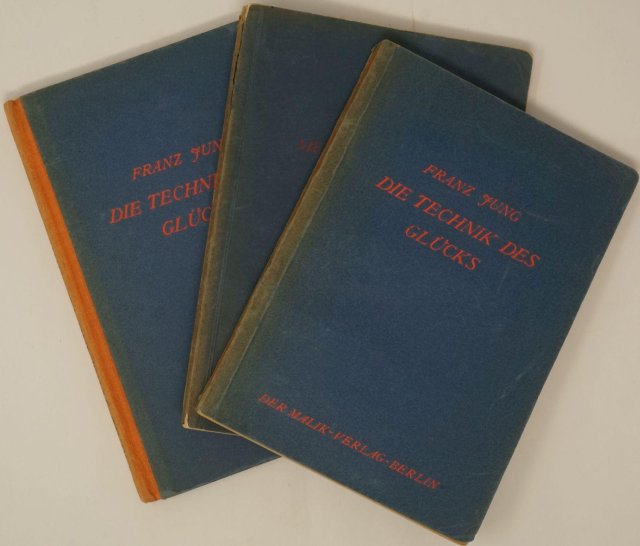- Kultur
- Robbie Williams
Einer wie wir
Vor 25 Jahren veröffentlichte Robbie Williams sein Debütalbum »Life Thru A Lens«

Damals, es war das Jahr 1995, weigerte sich Robbie Williams, noch länger der wohlerzogene Junge einer braven Boygroup zu sein, und kehrte Take That den Rücken. Damals, als er mit seiner ersten Solosingle, einer Coverversion von George Michaels »Freedom«, klarmachte: Er müsse jetzt ein anderer Mensch werden (»There’s someone else I’ve got to be«) und die Lügen der Vergangenheit in Wahrheiten verwandeln (»Take these lies and make them true somehow«). Hier wollte ein Teeniestar Adorno widerlegen und den Beweis antreten, dass selbst in dem scheinheiligen, imagegesteuerten Musikbusiness ein authentisches, wahrhaftiges Leben möglich ist.
Das gelang Robbie. Ohne Rücksicht auf Verluste und um den Preis verheerender Abstürze und vernichtender Schlagzeilen. Ohne das Korsett der Boygroup war er sich für keine Eskapade, keine Eselei mehr zu schade. Beherzt nahm er jeden Fettnapf mit. Und indem er so vieles falsch machte, machte er alles richtig. Denn wer vom Leben erzählen will, muss erst mal was erlebt haben.
Dies tat Robbie ausgiebig. Mag schon sein, dass er heftigere Erfahrungen machte als unsereins, die wir seine Lieder liebten. Sicher hatten Drogen und Groupies für ihn einen anderen Stellenwert als für uns, die wir schon froh waren, wenn das Bier seine Wirkung tat und die Freundin keine Migräne geltend machte. Aber dennoch verstanden wir ihn. Ihm wie uns fehlte etwas.
Wir hätten dieses »Etwas« nicht benennen können. Aber Robbie konnte es. Oder zumindest Guy Chambers, mit dem er seine Songs schrieb und der Robbies Gefühlsknäuel entwirrte und daraus griffige Parolen strickte. Zeilen, die seine und unsere Befindlichkeit rasierklingenscharf ausdrückten. Das tat weh und bewirkte zugleich Erleichterung – endlich jemand, der für unsere Weltwahrnehmung und die damit verbundene Enttäuschung und Bitternis die richtigen Worte fand!
»Wo wir auch hinkommen, sind wir zu spät dran. Oft denke ich, wir sind zum Hassen geboren. Wach auf und sieh den Sarkasmus in meinen Augen« (»When we come we always come to late. I often think that we were born to hate. Get up and see the sarcasm in my eyes«), heißt es in »Millennium«, einem Lied, das sich musikalisch bei Nancy Sinatras »You only live twice« bedient.
In »Supreme«, das Gloria Gaynors »I will survive« postmodern umformt, beklagt er: »Alle einsamen Herzen Londons sind ausgeflogen. Die besten Frauen sind alle verheiratet und die hübschen Männer alle schwul. Du fühlst dich ausgestoßen« (»All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived«).
Und in »Feel« – der letzten großen Single mit Guy Chambers aus dem Jahr 2002, als die beiden sich trennten – kennt er kein Halten mehr. Da platzt die ganze seelische Zerrissenheit, ja, Verwirrung ungefiltert aus ihm raus: »Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Rolle verstehe, die mir zugewiesen wurde. Ich sitze hier und spreche mit Gott, und er lacht nur über meine Pläne. Mein Kopf spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe« (»Not sure I understand this role I’ve been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don’t understand«).
Das alles klingt nach einem Fall für den Therapeuten. Und doch machten wir uns um Robbie nie ernsthaft Sorgen. Denn wir kannten ja auch seine andere Seite, die helle. Wenn er sich in Schale schmiss und mit einer Big Band die Royal Albert Hall swingte, verwandelte er sich in den begnadeten Entertainer, den einzigen würdigen Nachfolger von Frank Sinatra.
Und unerreicht war er, wenn er sich einen Spaß daraus machte, alle auf die Schippe zu nehmen, sich selbst am meisten. Wenn er Dinge einfach tat, die andere sich nicht trauten. Da wurde selbst ein Werbespot im Jahr 2000 zu einem Lehrvideo in Sachen Subversion: Erst äußert Robbie sich verächtlich über Künstler, die auf der Bühne Playback singen, und dass er dergleichen nie tun würde. Dann setzt er die Limoflasche an, doch während er trinkt, hört man ihn weiterreden. Seine Playback-Stimme betont, dass live zu singen etwas mit Respekt vor den Fans zu tun habe. Kann man den Mythos des ehrlichen, sich aufopfernden Rockmusikers lässiger zertrümmern? Seiner Plattenfirma wiederum bereitete er schlaflose Nächte, indem er öffentlich zum illegalen Herunterladen seiner Musik aufforderte. Solche Aktionen fielen ihm leicht, weil er die Welt als großen Abenteuerspielplatz sah, auf dem er sich nach Herzenslust austobte. Dann konnte es vorkommen, dass er allein eine komplette Fußballmannschaft bildete (auf dem Cover und im Booklet von »Sing When You’re Winning«) oder dass er in die Rolle des Formel-1-Fahrers Jackie Stewart schlüpfte (im Video zu »Supreme«). Dafür liebten wir ihn. Ihn, das große Kind, das seine Träume verwirklichte.
In seiner Mischung aus Zweifel und Traute, aus Selbstmitleid und Größenwahn, aus Schwermut und Leichtigkeit, aus Scheu und Lebensgier war er die ideale Identifikationsfigur für eine Generation, die gern gewusst hätte, wo sie hingehört. Die die Welt, mit der sie konfrontiert wurde, ebenso wenig verstand wie Robbie. Und die versuchte, daraus irgendwie das Beste zu machen. So wie er.
Das war damals. Heute – so scheint es – hat Robbie seine Dämonen besiegt. Er ist verheiratet und mehrfacher Familienvater. In Interviews wirkt er gelassen und ausgeglichen. Seine Musik ist komplett belanglos geworden.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.