- Berlin
- Parteipolitik
SPD-Kandidaten: »Kein Dauerabo auf eine Koalition mit der CDU«
Kian Niroomand und Jana Bertels wollen SPD-Landesvorsitzende werden

Seit der Abgeordnetenhauswahl 2011 hat die SPD in Berlin bei jeder Wahl verloren. Wie wollen Sie diesen Trend aufhalten?
Jana Bertels: Wir glauben, dass es jetzt notwendig ist, über gutes Tagesgeschäft hinaus wieder die weiten Linien und Perspektiven aufzumachen. Wir setzen darauf, die Mitglieder einzubeziehen, aber auch die Stadtgesellschaft. Wir wollen wieder mehr in die Vernetzung mit Vereinen, Initiativen und Gewerkschaften rein.
Kian Niroomand: Es geht um die Frage: Wofür steht die SPD als eine moderne Großstadtpartei? Die Leute wollen wissen, was unsere Antworten auf die großen Fragen der Stadt sind. Wir wollen einen Plan erarbeiten für diese Stadt.
Und was sind Ihre Antworten auf die großen Fragen der Stadt?
KN: Wir müssen es wieder schaffen, eine Klammer zu setzen um diejenigen, die man als Arbeiter definiert, und die Akademiker. Wir haben doch alle den gemeinsamen Nenner, dass wir mit manchen Problemen tagtäglich konfrontiert sind. Da geht es um die Verwaltung, gute Arbeit, aber auch um den Verkehr, vor allem in den Außenbezirken, oder bezahlbaren Wohnraum. Außerdem müssen wir die Bekämpfung von Armut stärker in den Blick nehmen.
In der vergangenen Woche haben der bisherige SPD-Landeschef Raed Saleh und die Bezirksverordnete Luise Lehmann ihre Kandidaturen erklärt. Stehen die beiden nicht für das Weiter-so, von dem Sie sich abgrenzen?
JB: Wir bewerten die Kandidaturen von Mitbewerber*innen nicht. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal: Wir streben keine Regierungsämter an und wollen uns ganz klar um die Partei kümmern. Wir kommen aus der Mitte der Partei und kennen sie aus dem tiefsten Inneren. Ich bin Vorsitzende der SPD-Frauen, Kian ist Kreisvorsitzender in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir kennen den Maschinenraum, über den wir reden.
Aber ist das nicht eher ein Nachteil, wenn Sie bislang nur in der Partei aktiv waren und kaum Kontakt zum politischen Gegner hatten?
KN: Wir waren beide zweimal an den Koalitionsverhandlungen beteiligt, 2021 mit Grünen und Linken und 2023 mit der CDU. Ich war auch in der Dachgruppe. In meinem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf habe ich auch die Verhandlungen um die Zählgemeinschaft in der Bezirksverordnetenversammlung geleitet. Das ist ein Bezirk mit über 300 000 Einwohner*innen, da geht es um viel. Wir haben uns einen Blick von außen bewahrt. Wir sind eben nicht nur in dieser Mühle drin, sondern kennen auch viele Problemlagen der Berliner*innen selbst, zum Beispiel, als junge Eltern bei der Suche nach einem Kita-Platz.
Jana Bertels und Kian Niroomand kandidieren für den SPD-Landesvorsitz. Die Verwaltungswissenschaftlerin Jana Bertels ist aktuell Landesvorsitzende der SPD-Frauenvereinigung. Der promovierte Volkswirt Kian Niroomand ist Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf.
Die SPD steht jetzt vor der Situation, dass mit Ihnen ein linkes Duo gegen ein rechtes Team von Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini sowie ein mittiges Duo von Raed Saleh und Luise Lehmann antritt. Konnten Sie sich im Vorfeld nicht auf eine flügelübergreifende Lösung einigen?
KN: Wir vertreten linke Positionen, aber unser Anspruch ist, anschlussfähig an weite Teile der Partei zu sein. Ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass wir jetzt einen offenen Wettbewerb haben. Es gibt unterschiedliche Angebote, davon lebt die Demokratie. Es liegt an uns allen, im Anschluss die Partei zusammenzuführen.
JB: Es mobilisiert auch die Mitglieder mehr, wenn es so einen Willensbildungsprozess und eine Auswahl gibt. Dass sich die Mitglieder mehr einbringen können, ist uns ein wichtiges Anliegen.
Gegen das Vorhaben einer Mitgliederbefragung sollen Sie sich im SPD-Landesvorstand aber ausgesprochen haben.
KN: Wir kommentieren grundsätzlich keine Interna aus den Gremien. Wir sind offen für dieses Verfahren und freuen uns so, wie es kommt.
In Ihrem Bewerbungsschreiben sagen Sie, dass die SPD wieder progressive Koalitionen anführen sollte. Ist die CDU ein progressiver Partner?
KN: Dass wir jetzt in einer Koalition mit der CDU sind, war eine mehrheitlich getroffene Entscheidung, die es zu akzeptieren gilt. Uns geht es darum, dass wir einen guten Regierungsjob machen. Aber man muss auch darüber hinausdenken. Natürlich sehen wir größere Überschneidungen mit Linken und Grünen und müssen darüber nachdenken, wie man perspektivisch diese Stadt wieder führen kann.
JB: Der Punkt ist: Wir sind nicht die Kandidat*innen, mit denen man ein Dauerabo als Juniorpartner der CDU zieht.
Was sind für Sie denn die größten Erfolge der schwarz-roten Koalition?
JB: Bei dem, was in den Haushaltsberatungen beschlossen wurde, ist schon viel passiert. Wenn ich auf den Bereich der Gleichstellung sehe, aus dem ich komme, dann sehe ich große Fortschritte. Zum Beispiel bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen oder bei der Netzwerkarbeit im Bereich Alleinerziehende.
Aber bessere Netzwerkarbeit war ja nicht der Anspruch, mit dem die SPD in die Koalition gegangen ist.
JB: Die Ziele sind insgesamt natürlich höher gestellt. Aber wir sind nicht angetreten, um morgen aus dieser Koalition rauszukommen. Wir akzeptieren, dass es eine Mehrheit gab für diese Entscheidung. Falls wir gewählt werden, werden wir aber reingehen, wenn Sachen nicht umgesetzt werden, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, oder darüber hinausgehen. Das ist die Rolle, in der wir uns sehen.
Sie schreiben auch, dass die SPD »von der Kultur des unbedingten Machterhalts« wegkommen müsse. Geht die SPD dann in die Opposition?
KN: Nein, das war mehr in der Rückschau betrachtet. Ich finde schon, dass wir nach der Wahlniederlage hätten sagen müssen: Lasst uns demütig sein. Lasst uns anerkennen, dass wir bei dieser Wahl verloren haben. Es täte uns gut, mehr Ehrlichkeit in die Politik reinzubringen.
Sie streben keine Regierungsämter an, andere dagegen schon. Franziska Giffey hat erklärt, dass sie sich vorstellen kann, 2026 wieder Spitzenkandidatin zu werden. Würden Sie das unterstützen?
JB: Wir reden jetzt über den Parteivorsitz und nicht die Spitzenkandidatur. Wichtig ist, dass wir ein Verfahren brauchen, wie die Spitzenkandidatin für 2026 gefunden wird. Eine Entscheidung vorwegzunehmen, würde ich nicht für richtig halten.
Herr Hikel und Frau Böcker-Giannini haben angekündigt, wieder Kita-Gebühren einführen zu wollen. Wie stehen Sie dazu?
JB: Wir halten das für einen fundamentalen Fehler. Die gebührenfreie Kita ist eine Errungenschaft, die die Sozialdemokratie erkämpft hat. Die Mieten und alltägliche Kosten steigen immer weiter, und wenn dann noch die Kita-Gebühren für Kinder obendrauf kommen, wird es auch für eine Mittelschichtfamilie schon knapp. Das ist nicht das Signal, das sozialdemokratische Politik senden sollte.
KN: Wir erkennen an, dass die Haushaltslage nicht mehr so rosig wie in den letzten Jahren aussieht, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber wir müssen darüber sprechen, wie wir Errungenschaften der öffentlichen Daseinsvorsorge schützen können. Wir brauchen da alternative Finanzierungsmodelle, mit denen wir den Kernhaushalt entlasten können.
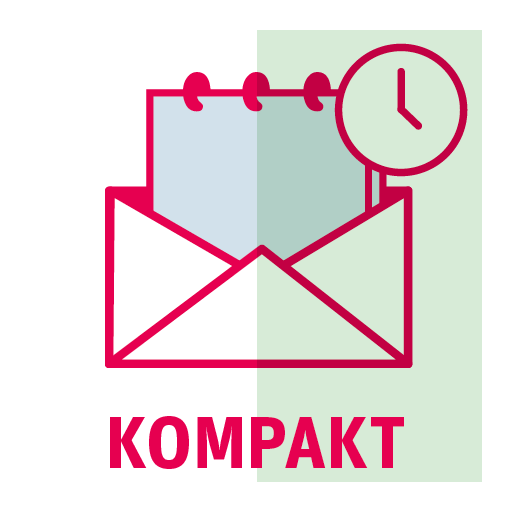
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Das müssen Sie genauer erklären.
KN: Ich denke da an einen Darlehensfonds. Man vergibt an Unternehmen Darlehen, die an Voraussetzungen, wie zum Beispiel Tariftreue, geknüpft sind. Dadurch wird der Kernhaushalt nicht belastet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir müssen flächendeckend unsere Gebäude klimaneutral machen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man die für die Sanierung notwendigen Darlehen aus einem solchen Darlehensfonds nimmt. Das wäre am Ende auch unbürokratischer als andere Finanzierungswege.
Mit der neuen Kooperationsvereinbarung dürfen die landeseigenen Wohnbaugesellschaften die Mieten anheben. Wie stehen Sie dazu?
KN: Es geht um moderate Mieterhöhungen, denn auch die landeseigenen Wohnbaugesellschaften sind mit gestiegenen Baukosten konfrontiert. Damit sie bezahlbaren Wohnraum schaffen können, waren diese Erhöhungen leider notwendig. Die Kritik des Mietervereins daran muss ernst genommen werden. Klar ist: Mieterhöhungen dürfen in keinem Fall zu Verdrängung führen, und die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften müssen mit gutem Beispiel vorangehen.
Parallel wurde der Kreis der Bezieher des Wohnberechtigungsscheins ausgeweitet. Wenn jetzt die Mieten für die Bestandsmieter steigen und gleichzeitig auch mehr, tendenziell besserverdienende Mieter in das System reinströmen – können die Landeseigenen dann überhaupt noch ihre Aufgabe erfüllen?
KN: Deswegen sage ich, dass wir die Landeseigenen in die Lage versetzten müssen, mehr Wohnungen schaffen zu können. Das ist für mich die Lösung des Problems. Auch da können wir wieder über Darlehensfinanzierung sprechen.
Damit mehr privater Wohnraum entstehen kann, will der Senat mit dem Schneller-Bauen-Gesetz unnötige Vorschriften abschaffen. Wo sehen Sie die Grenzen der Deregulierung?
JB: Beim Brandschutz darf es keine Kompromisse geben. Auch nicht beim Lärmschutz – da zu reduzieren, ist in einer Stadt, in der viele Menschen unter Lärm leiden, nicht die richtige Lösung.
Viele befürchten, dass am Ende vor allem ökologische Vorgaben gestutzt werden könnten.
KN: Wir brauchen klimaneutralen Wohnraum. Es geht gar nicht so sehr um die Prüfkriterien, sondern eher um die Länge der Prüfprozesse. Da geht es dann darum, die Verwaltung mit genügend Personal auszustatten. Man kann auch darüber nachdenken, dass man das Verfahren für die Bebauungspläne standardisiert, damit es nicht immer einen individuellen Bebauungsplan geben muss. Das würde schon viel Geschwindigkeit reinbringen.
Auf dem Tempelhofer Feld wäre viel Platz für neue Wohnungen, aber ein Volksentscheid hat die Bebauung verhindert.
JB: Ich persönlich denke, man kann da nicht bauen, ohne die Kriterien festzulegen, wer und unter welchen Bedingungen. Es muss klar sein, dass da am Ende nicht Investoren-Burgen entstehen, sondern Sozialwohnungen. Eine andere Frage ist, wie man sicherstellt, dass auch die Mehrheit der Stadt diese Bebauung wünscht. Das Instrument eines Volksentscheids von oben halte ich für denkbar falsch. Es ist keine direkte Demokratie, wenn die Regierung von oben die Fragen definiert. Ich halte das für ein gefährliches Instrument, das auch missbraucht werden könnte. Besser wäre ein sogenannter fakultativer Volksentscheid wie in Hamburg oder Bremen, mit dem ein erneuter Volksentscheid mit weniger Stimmen einberufen werden kann, wenn das Parlament einen Volksbeschluss ändert.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







