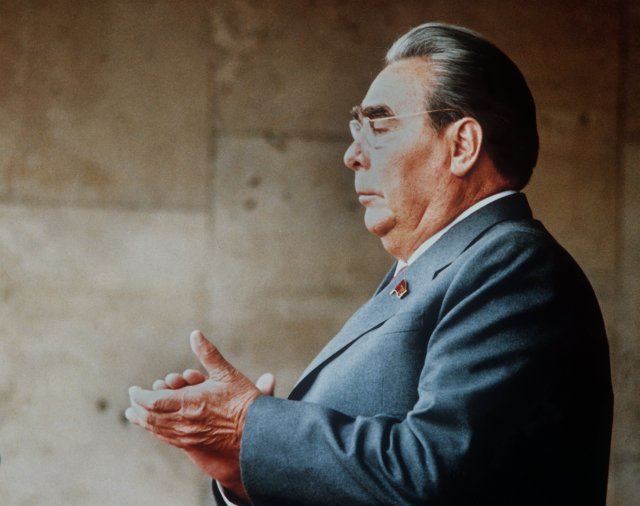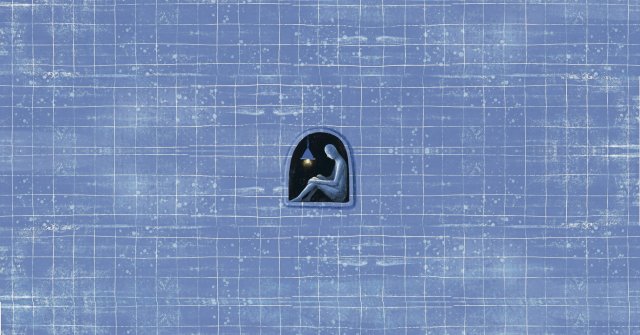- Kultur
- »Sirât« im Kino
Nichts als Staub
Óliver Laxes dystopisch aufgeladenes Road Movie »Sirât« ist ein ebenso origineller wie beunruhigender Film

Wir betrachten Menschen, die, irgendwo in der Wüste, eine Lautsprecheranlage zusammenschrauben, wobei sie Schalter umlegen, Stecker irgendwo reinschieben. Junge und mittelalte, sich für individuell haltende Menschen mit Tätowierungen und asymmetrischen Frisuren tanzen selbstvergessen und bewegen sich zu anschwellenden Techno-Beats. Es ist eine Raver-Community unter der sengenden Sonne im Nirgendwo, der wir zusehen. Sie sind ein Stamm, ein Tribe, Techno-Nomaden, und sie haben sich hier versammelt, um ein dionysisches Ritual abzuhalten, sich vollständig dem Klang der elektronischen Sounds hinzugeben. Am Anfang steht also der Rausch, die Selbstauflösung des Ichs in der Musik. Wir hören die wummernden Bässe, den stoisch hämmernden Beat. Wumms, wumms, wumms. Die hypnotische Musik ist das Werk des französischen Techno-DJs Kangding Ray: Ein Sound, der uns für die Dauer des Films begleiten wird, ihm mitunter seine immersive Qualität verleiht.
Mittendrin ein älterer Mann mit seinem kleinen Sohn. Beide, das sehen wir, gehören nicht hierher. Sie bewegen sich eher verunsichert und unbeholfen durch die tanzende Meute ausgemergelter Freaks, halten Ausschau, versuchen sich zu orientieren. Der grauhaarige Mann, der erkennbar der scheinbar intakten Welt des Bürgertums entstammt, Luis, ist auf der Suche nach seiner Tochter, die vor Monaten spurlos verschwand und nicht mehr wiederkam und von der er annimmt, sie befinde sich irgendwo hier unter den Feiernden. Luis hat Esteban bei sich, seinen vielleicht achtjährigen Sohn. Beide verteilen Handzettel, auf dem das Konterfei der vermissten Teenagerin zu sehen ist.
Zwei Welten stoßen hier aufeinander: Die einen suchen im Rausch das Vergessen, die anderen erinnern sich und können nicht vergessen. Luis lernt schließlich ein paar der Techno-Hippies näher kennen, von denen er erfährt, dass es in diesen Tagen noch einen weiteren Rave geben wird, irgendwo tief in der Wüste, und dass seine Tochter möglicherweise dort zu finden sein wird.
Dass in diesem Kosmos irgendwas nicht in Ordnung ist, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, wird spätestens klar, als plötzlich das Militär anrückt, die Feiernden einkesselt und den Rave für beendet erklärt. Von einer Notstandsregelung ist die Rede: »Alle Europäer haben sich in ihre Fahrzeuge zu begeben und das Land zu verlassen.«
Doch Luis befolgt die Anordnungen nicht, sondern schließt sich zusammen mit seinem kleinen Sohn, in der Hoffnung, die verlorene Tochter wiederzufinden, mit seinem Mittelklasse-Van seinen neuen Bekannten an: jener Handvoll Dropouts, die mit ihren beiden ramponierten Trucks zum nächsten Rave aufbrechen. Einem der Aussteiger fehlt eine Hand, einem anderen das linke Bein. Nicht ausgeschlossen, dass die versehrten Körper als Hinweis auf die versehrte Welt gelesen werden müssen, in der wir uns befinden. Fortan geht’s mit den zu Wohnmobilen umgebauten, schweren Fahrzeugen tage- und nächtelang durch die nordafrikanische Einöde: über staubige Ebenen, über Geröll und durch unwirtliche Fels- und Gebirgslandschaften, Serpentinen entlang, die kargen Vorräte miteinander teilend. Es wird eine Reise ins Unbekannte. Und immer brennt in dieser kargen, Mad-Max-artigen Wüstenlandschaft die Sonne, brummen die Bässe, knattert der Beat dazu. Als Luis eines Abends mit einer der Technohippiefrauen, die gerade mit der Reparatur einer Lautsprecherbox beschäftigt ist, in deren Truck zusammensitzt und die Klangqualität der lädierten Box moniert, antwortet ihm die Frau: »Man soll auch nicht hören, sondern tanzen.« Man soll nicht mehr da sein, soll sich im Sound verlieren, soll mit dem Rhythmus verschmelzen, sich auflösen wie im LSD-Rausch.
Die spärlichen Gespräche, die geführt werden, sind die Gespräche von Suchenden und gleichzeitig der Welt Entfliehenden. Wir erfahren aus ihnen nicht viel über den Weltzustand, doch das wenige, das wir erfahren, reicht aus, um zu wissen, dass es nicht zum Besten bestellt ist um den Planeten: Das Radio meldet Beunruhigendes; einiges deutet darauf hin, dass sich die Welt an der Schwelle eines Weltkrieges befindet; das Benzin ist teuer und knapp; selbst mitten in der Wüste sind gelegentlich Militärkonvois unterwegs. Doch nichts Genaues weiß man nicht. »Fühlt sich so der Weltuntergang an?«, fragt eines Nachts am Steuer des Trucks einer der Protagonisten, und sein Nebenmann antwortet ihm: »Nein, der Weltuntergang findet schon sehr lange statt.« Man kann zu ihm tanzen, doch der Tod lässt sich nicht vermeiden.
Als Zuschauer wird man mit der Zeit den Eindruck nicht mehr los, dass diese Fahrt immer tiefer ins Niemandsland führt.
»Sirât« ist der vierte Film des französischen Regisseurs und Drehbuchautors Óliver Laxe. Der Film, der im Lauf der von ihm erzählten Geschichte mit mindestens einer althergebrachten Konvention bricht und der für den empfindsamen beziehungsweise leicht zu verstörenden Betrachter den einen oder anderen Schockmoment bereithält, gewann dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis der Jury. Über weite Strecken muss man ihn wohl als ein surreales Road Movie begreifen, das unsere eigenwilligen Protagonisten auf ihrem Trip durch die Wüste begleitet. Man fährt, ist unterwegs, ist immer in Bewegung. Und als Zuschauer wird man mit der Zeit den Eindruck nicht mehr los, dass diese Fahrt immer tiefer ins Niemandsland führt. Irgendwann gegen Ende sehen wir in einer Szene Luis durch die vom Sonnenlicht grellweiß eingefärbte Wüste torkeln. »Hier gibt es nichts als Staub«, wird er am Ende der Szene resigniert sagen.
Der Film ist zugleich eine Art dystopisch aufgeladener Gegenwartswestern und ein existenzielles Drama über das Leben und den Tod und die sehr dünne Linie, die das eine vom anderen trennt. Und das manchmal unbarmherzige an- und abschwellende Brummen, Dröhnen, Wummern und Sirren der Tonspur bildet dabei das akustische Pendant zu dem teils quälenden Geschehen, das in der zweiten Hälfte des Films erzählt wird. Die Filmkritikerin Jessica Kiang beschwerte sich in der Zeitschrift »Variety«, dem Branchenblatt der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie, darüber, dass der Regisseur mit seinem Film die Zuschauer »emotional und psychologisch fertigmacht«. Wobei ihr das Kunststück gelang, die Zuschauer vor der Betrachtung des Films zu warnen und gleichzeitig dem Regisseur ein Kompliment zu machen: »Nicht viele Filme können einen Fluchtinstinkt auslösen und einen gleichzeitig an den Sitz fesseln.« Nach dem Ende des Films versteht man dann auch, warum der Verleih die Kinobetreiber darum bittet, ihn im Kino mit leicht erhöhter Lautstärke abzuspielen.
»Sirât«, Frankreich/Spanien 2025. Regie: Óliver Laxe, Buch: Santiago Fillol, Óliver Laxe. Mit: Sergi López, Bruno Núñez, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Jade Oukid, Richard Bellamy. 115 Min. Kinostart: 14. August.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.