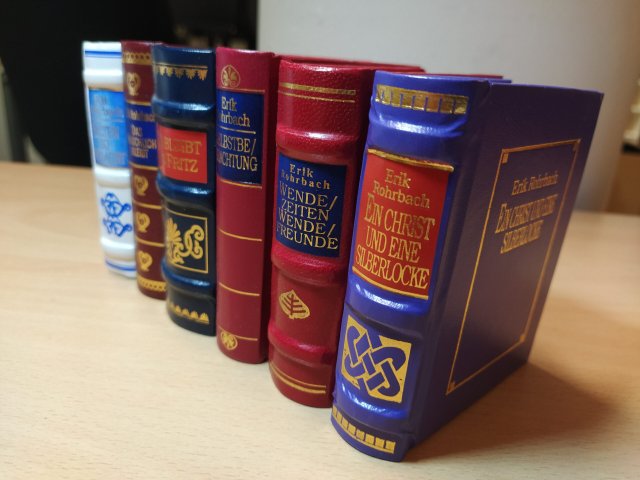- Berlin
- Görlitzer Park
Im »Görli« galt immer: »Alles offen für alle«
Ein historischer Rundgang durch den »Görli« zeigt das lange Ringen um das Beste für die Anwohner

»Das Motto hier war eigentlich schon immer: Für jeden etwas und alles offen für alle.« Neben den Überresten der »Harnröhre« stehend, beschreibt Kessi Schmidt, was der Görlitzer Park lange Zeit war: regelloser Abenteuerspielplatz für Kinder wie Erwachsene, Schrottplatz, Do-it-yourself-Garten und -Werkstatt, Freizeit- und teilweise auch verseuchter Gefahrenort – gleichzeitig. Und die »Harnröhre«? Damals gar nicht sichtbar: ein Tunnel nämlich, der die Wiener Straße mit dem Wrangel-Kiez verband. Eigentlich gebaut, damit die Leute nicht um das Niemandsland herumlaufen mussten, das heute der Park ist, schnell aber zur Toilette verkommen für all jene, die sich dort Tag und Nacht aufhielten. Als später die große Senke ausgehoben wurde, über die heute Frisbees fliegen, kam der Tunnel zum Vorschein, von dem inzwischen nur noch Mauerreste übrig sind.
Die Autorin Kessi Schmidt wurde von der Helle Panke e. V. - Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin zu einem Stadtrundgang eingeladen, um über die Geschichte eines Ortes zu erzählen, der für Kreuzberg schon lange eine zentrale Bedeutung hat, die auch weit über die Bezirks- und Stadtgrenzen hinausstrahlt: Am »Görli« werden seit Jahrzehnten gesellschaftliche Diskurse und Schieflagen sichtbar. Sie drehen sich um innere Sicherheit, Migration, Gentrifizierung, um Sucht, Elend, Verwahrlosung. Heute möchte der Berliner Senat all dem kurzerhand von oben mit einem Zaun und Schließzeiten begegnen – zum Ärger vieler Anwohner*innen, die sich in Initiativen wie »Görli zaunfrei!« engagieren. Doch das war nicht immer so. Vor allem war der »Görli« nie unzugänglich, auch nicht zu bestimmten Tageszeiten, sondern spiegelt eine Geschichte vom urbanen Ringen ums Beste für alle wider, von Eroberung städtischen Raums, Anwohnerinitiativen und Selbsthilfe.
1866 als Kopfbahnhof eröffnet, fuhren von hier aus viele Jahre Züge nach Lübben, Cottbus, Görlitz, auch nach Wien. Der erste Zug transportierte noch vor der offiziellen Eröffnung Soldaten in den Preußisch-Österreichischen Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg noch funktionsfähig, wurde der Bahnhof weiter genutzt, bis der Personenverkehr in den 60er Jahren eingestellt wurde. Als auch der Güterverkehr zum Erliegen kam und die Gebäude abgetragen wurden, war das Gelände etwa ab den 80er Jahren eine frei zugängliche Brache, auf der Menschen Lagerfeuerfeste feierten, ihre Autos reparierten, Kinder im Matsch spielten, wo Kohle gelagert wurde und Künstlergruppen gastierten. Es gab eine Schrottpresse, die Teile des Geländes verseuchte. Früh nutzten die türkischen Frauen – damals noch als »Gastarbeiter« wahrgenommen – die Fläche, um Wolle zu waschen und zu Garn zu verarbeiten.
Klingt nach Abenteuerspielplatz. Zur Wahrheit gehört aber auch: »Wenn die Leute heute sagen, der Görli sei so gefährlich geworden, denke ich immer auch an diese Zeit. Ich kann mich noch erinnern an die Grafittis ›Vergewaltiger, wir kriegen euch‹ und wie Anwohner denen dann aufgelauert haben«, erzählt Schmidt.
Anwohner*innen forderten schon Anfang der 80er Jahre einen Stadtpark. Nachdem lange nichts passiert war, fingen sie an, die Forderung selbst umzusetzen. »Das Gelände wurde in Besitz genommen, lange bevor offiziell etwas passiert ist«, sagt Schmidt. Ein Spielplatz und der Kinderbauernhof am Eingang Liegnitzer Straße zeugen heute noch von der einstigen Elterninitiative.
Schließlich gab es 1984 einen Ideenwettbewerb zur Gestaltung des Parks. Der Siegervorschlag gewann wegen der Integration des bestehenden Bauernhofes und der sorgfältigen Auswahl von Pflanzen. Teile eines Rosengartens existieren noch. Abgesperrt war der »Görli« nie, wie während des Rundgangs auch ein Sprecher von »Görli zaunfrei!« betont: »Wir wollen nichts kleinreden, aber der Fokus des Senats auf Kriminalität ist eindimensional. Die Nutzung des Parks ist facettenreich, die Leute brauchen das, weil es hier so wenig Grün gibt.« Es gehe schließlich um die Frage: Sicherheit für wen? »Auch Menschen ohne Wohnung oder Suchtkranke müssen sicher sein. Deswegen wollen wir das ganzheitlich angehen. Obdachlosigkeit, Gewalt, Drogen, nichts davon löst sich mit einem Zaun auf.«
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.