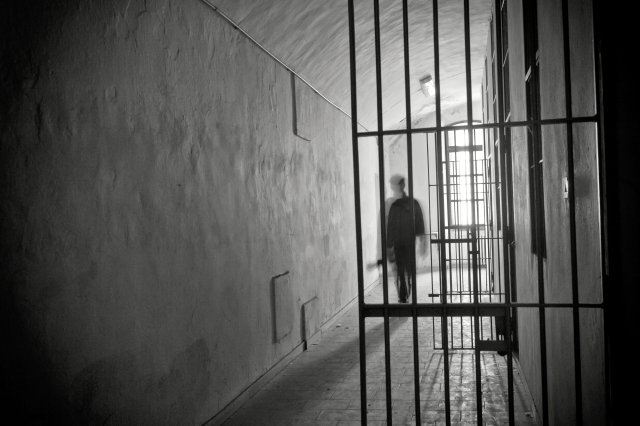- Politik
- Zwangsrekrutierung
Ukraine: Lieber leben als heroisch sterben
Der Widerstand gegen die Zwangsrekrutierungen wird in der Ukraine immer sichtbarer und radikaler

Vor wenigen Tagen in einem Rekrutierungszentrum in Kiew: Ein blutüberströmter Mann liegt mit aufgeschnittenen Venen auf dem Boden. Er war mobilisiert worden und sollte zu seiner Einheit gebracht werden – stattdessen nahm er sich das Leben.
Derartige Fälle »radikalen Protests« haben sich zuletzt in Transkarpatien, der Region Mykolajiw, in Kiew, Riwne, Lwiw und Poltawa ereignet. Einige Männer erklärten ihre Selbstmordversuche gegenüber Medien damit, dass sie rechtswidrig festgenommen und körperlich oder psychisch misshandelt worden seien. Gegenüber dem Nachrichtenportal »Apostrophe« berichtete ein Betroffener, man habe ihm das Telefon weggenommen, damit er niemanden informieren konnte, und zur Unterzeichnung des Einberufungsbefehls gezwungen.
Derartige Geschichten schockieren in der ukrainischen Gesellschaft kaum noch jemanden. In den vergangenen Jahren haben sich die Menschen an den Tod und die verzweifelten Versuche, ihm zu entgehen, gewöhnt. Der Begriff des »heroischen Tods für die Ukraine« hat für die meisten Männer an Attraktivität verloren. Stattdessen versuchen sie, dem blutigen Krieg auf irgendeine Weise zu entkommen. »Gewöhnliche« Männer, die nicht vor einer russischen Drohne fliehen oder die verstreuten Überbleibsel eines von einer Mine zerrissenen Kameraden einsammeln wollen, stellen inzwischen offenbar die Mehrheit. Denn etwa sechs Millionen haben ihre Angaben nicht bei den Rekrutierungszentren aktualisiert, wie es das Kriegsrecht eigentlich vorschreibt.
Aus purer Verzweiflung
Viele Männer, die zwangsweise in die Rekrutierungszentren gebracht werden, nehmen das als Todesurteil wahr. Sie werden trotz ihrer Angst, fehlender Kenntnisse und bisweilen sogar trotz schwerwiegender gesundheitlicher Probleme eingezogen. Selbst Fälle, bei denen man Menschen mit Krebs, Tuberkulose oder Alkoholismus für diensttauglich erklärte, wurden bekannt.
Auch in Russland gab es trotz der heftigen Repression in den vergangenen Jahren Widerstand gegen Zwangsrekrutierungen. Die Proteste gegen die Teilmobilmachung und der Massenexodus von etwa 260 000 jungen Russen im Herbst 2022 veranlasste die Putin-Regierung jedoch, auf Zwangseinberufungen zu verzichten. Stattdessen setzt Moskau seitdem auf eine Mobilisierung, bei der man nur diejenigen an die Front schickt, die »wollen oder nicht ablehnen können«, wie es ein russischer Menschenrechtsanwalt gegenüber der Online-Zeitung »Moscow Times« ausdrückte.
So rekrutiert die russische Armee ihre Soldaten besonders unter ethnischen Minderheiten und den ärmsten Bevölkerungsteilen auf dem Land, die von den Soldzahlungen und möglichen Entschädigungen an die Familien angelockt werden. Laut »Moscow Times« werden den Rekruten 200 000 Rubel (etwa 2100 Euro) monatlich versprochen. Zudem bietet die Armee verurteilten Straftätern einen Hafterlass, wenn sie sich für die Front melden.
Im Juli erweiterte die russische Regierung auch die Möglichkeiten für den Einsatz ausländischer Kämpfer, die nun ganz regulär Teil der Streitkräfte werden können. Des Weiteren gibt es ausländische Söldner und offenbar auch 12 000 nordkoreanische Soldaten, die im Rahmen eines bilateralen russisch-nordkoreanischen Militärabkommens eingesetzt werden.
Auf dubiose ausländische Unterstützung setzt allerdings auch die Ukraine. Der spanischen Wirtschaftszeitung »El Economista« zufolge hat die Regierung in Kiew den Einsatz von 8000 ausländischen Freiwilligen anerkannt. Fast die Hälfte von ihnen stammt, laut »El Economista«, aus Südamerika und hiervon wiederum der mit Abstand größte Teil aus Kolumbien.
Die Armee des südamerikanischen Nato-Partners hat im Bürgerkrieg der letzten Jahrzehnte systematisch Menschenrechte verletzt, zahlreiche Massaker begangen und tausende Jugendliche verschwinden lassen. Trotzdem sind die kolumbianischen Elitesoldaten begehrt – sie besitzen Kampferfahrung. Die Ukraine verspricht ihnen einen Lohn von 3000 bis 4000 Euro monatlich.
Der Umstand, dass heute kaum noch jemand, der in ein Rekrutierungszentrum gebracht wird, nach Hause zurückkehren darf, veranlasst immer mehr Männer zu lebensgefährlichen Handlungen. In den Medien waren Berichte zu lesen, wonach Betroffene in Khmelnytskyi, Dnipro und in Lokachi in Rekrutierungszentren aus dem Fenster sprangen. Die meisten von ihnen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. In Charkiw starb ein 39-Jähriger. Ein weiterer Todesfall ereignete sich in Kiew, wo ein frisch rekrutierter Mann aus einem Fahrzeug der Rekrutierungseinheiten zu entkommen versuchte.
Anders als im Frühjahr 2022, als die russischen Truppen auf die Hauptstadt zumarschierten, wollen die Männer nicht mehr in den Krieg ziehen. Sie glauben nicht länger an die »Siegespläne« des Präsidenten und weigern sich, ihr Leben in einer endlosen Auseinandersetzung zu opfern. Zu oft hören sie, dass Frauen getöteter oder vermisster Soldaten vor Gericht klagen müssen, um die den Familien zustehenden Zahlungen zu beziehen. Oder sie haben Geschichten von »Schlächter-Kommandeuren« erzählt bekommen, deren realitätsfremde Befehle unzähligen Soldaten das Leben gekostet haben. Berichtet wird des Weiteren von einer ungenügenden und überstürzten militärischen Ausbildung der Rekruten und von weitverbreiteter Korruption. Es werden Geldsummen genannt, die man Kommandeuren zahlen muss, um nicht an die Front geschickt zu werden.
Gewaltsamer Widerstand
Die Verzweiflung der Männer kommt nicht nur in Fluchtversuchen und Selbstverstümmelungen zum Ausdruck. Immer häufiger kommt es auch zu gewaltsamem Widerstand, wenn Männer auf der Straße rekrutiert werden sollen. Die Betroffenen weigern sich, ihre Papiere zu zeigen und in Militärfahrzeuge zu steigen, oder rufen mit Verweis auf kleine Kinder und pflegebedürftige Eltern Passanten um Hilfe. In einigen Fällen setzen sie sich mit Stöcken, Steinen, Pfeffer-Spray und sogar Feuerwaffen zur Wehr.
Nicht selten sind es aber auch die Passanten, die die Männer aus den Händen der Soldaten befreien oder das Rekrutierungspersonal und ihre Fahrzeuge angreifen. Frauen übernehmen in derartigen Situationen häufig die Führungsrolle. Ihr Mut hat auch damit zu tun, dass die Feldjäger sie nicht mit der Einberufung bedrohen können, da der Militärdienst für Frauen nicht verpflichtend ist.
Die Frauen, die gegen die Rekrutierungen Widerstand leisten, kommen aus allen Altersgruppen. Sie schlüpfen in die symbolische Rolle der beschützenden Mutter, Ehefrau, Schwester oder Tochter. Die konventionelle Geschlechterrolle legitimiert ihr illegales Verhalten in den Augen der Öffentlichkeit und schützt vor Strafverfolgung. Bemerkenswerterweise sind gelegentlich selbst Frauen, deren enge Verwandte an der Front dienen, unter denjenigen, die andere Männer vor der Rekrutierung zu schützen versuchen.
»Ich bin hier, weil mein Bruder sich für drei Jahre verpflichtet hat und ich niemandem wünsche, dass er erlebt, was mein Bruder im Schützengraben durchmacht«, erklärte eine Frau, die sich unlängst an einem der organisiertesten Anti-Rekrutierungs-Proteste in Vinnytsia beteiligte, gegenüber der Nachrichten-Webseite »TCH«. Dutzende Menschen hatten sich in der Ortschaft vor einem Gebäude versammelt, in dem mehrere Hundert rekrutierte Männer festgehalten wurden. Der Protest mündete in Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte und mehrere Demonstrant*innen verhaftete.
»Alleinerziehende Väter«
Die notorische Korruption erleichtert es den Unwilligen, sich dem Militärdienst zu entziehen. Gewöhnlich reichen Geld und Beziehungen aus, um das Problem zu lösen. Doch diese Möglichkeit steht keineswegs allen offen – was den Krieg zu einem Problem der Armen macht.
Ein populärer Ausweg ist der Trick des »alleinerziehenden Vaters«. Dafür täuschen Betroffene eine Trennung von der Kindsmutter vor und lassen sich bei der Scheidung das alleinige Sorgerecht geben. Auf diese Weise wird der Vater zum Alleinversorger der minderjährigen Kinder, was ihm das Recht gibt, das Land zu verlassen. Ein einziges Gericht in der Donez-Region erließ mehr als 120 solcher Urteile. Vierzig dieser Männer waren bereits ausgereist.
Ein weiterer Trick besteht in der Pflege schwerkranker Angehöriger. Aus demselben Grund werden auch Fake-Ehen mit behinderten Frauen oder Müttern mit drei oder mehr Kindern immer populärer. Als Fluchtoption dient zudem der Bildungssektor. Männer schreiben sich massenhaft als Studierende ein oder übernehmen eine Stelle als Lehrer – was in der Ukraine, wo der Lehrerberuf aufgrund des niedrigen Lohns und geringer Anerkennung zu den feminisiertesten Jobs gehört, verdächtig wirkt. Als der Ehemann der Abgeordneten Nataliya Pipa, der bis dahin als IT-Unternehmer tätig war, eine Anstellung als Lehrer annahm, sorgte das unter den Wähler*innen der Abgeordneten für einigen Unmut.
Andere Strategien zur Wehrdienstverweigerung sind (oftmals gefälschte) Beschäftigungsverhältnisse bei »kritischen Unternehmen«, die ihre Mitarbeiter von der Wehrpflicht befreien können, ein betrügerisch erworbener Behindertenstatus oder der Erwerb von Papieren, die vorübergehende Auslandsreisen ermöglichen. Diese Lücke haben tausende Ukrainer aus dem Kultur- und Sportbereich genutzt – sie sind auf Auslandsreise gegangen und nicht zurückgekehrt. Wie das Nachrichtenportal »360UA News« schreibt, befinden sich unter den Flüchtigen Politiker, Regierungsbeamte und deren Angehörige.
Der Widerstand gegen die Zwangsmobilisierungen wird immer sichtbarer und radikaler. Die Eliten des Landes versuchen, ihn mit Verhaftungen, Gewalt und Drohungen zu unterdrücken. Die Kriegspropaganda stigmatisiert die Aktivist*innen der Anti-Mobilisierungsbewegung als »gewissenlos«, als Verräter oder sogar als russische Agenten, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Doch vielleicht wird die Zeit kommen, in der man diese Menschen im Rückblick als Teil einer Bewegung für Frieden, Freiheit und Menschenrechte betrachten wird.
Marta Havryshko ist ukrainische Historikerin und forschte vor dem Kriegsausbruch zum Einsatz sexueller Gewalt in Kriegen und Genoziden. Wegen ihrer Nationalismuskritik wurde sie in der Ukraine massiv bedroht. Heute lebt sie in den USA.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.