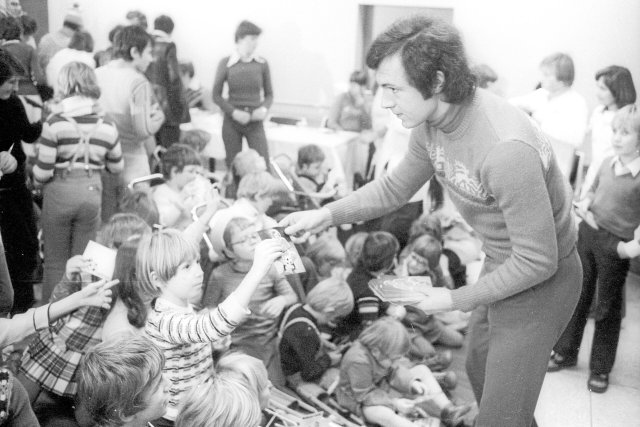- Kultur
- Geschichte des Marxismus
Hegel und Anti-Hegel
Wer war Galvano Della Volpe? Zur Neuübersetzung von »Logik als historische Wissenschaft«

In der Naturschutzbiologie spricht man vom Lazarus-Effekt, wenn Arten oder Unterarten wiederentdeckt werden, von denen man dachte, sie seien ausgestorben. Der Begriff geht zurück auf die biblische Figur des Lazarus aus dem Johannes-Evangelium. Darin belebt Jesus den späteren Patron der Totengräber wieder, nachdem dieser Tage zuvor in einer Höhle beigesetzt worden war.
Mit anderen Worten: Totgesagte leben länger. Und was in den Naturwissenschaften und der Theologie schon lange bekannt ist, gibt es auch in der Philosophie. Dort konnte man in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Wiederbelebung eines »toten Hundes« beobachten, nämlich Johann Friedrich Wilhelm Hegel. Gegenwärtig ist kaum ein Denker in der akademischen Welt so präsent wie er. Kein Werk des Schwaben und kein Aspekt seiner Denkwelt bleiben ausgespart, keine der dominanten philosophischen Strömungen verzichtet auf eine Hegel-Interpretation. Selbst in der Analytischen Philosophie, die sich lange gegen eine Rezeption gesperrt hat, werden mittlerweile voluminöse Kommentare vorgelegt, und in der französischen Philosophie ist das Verhältnis zu Hegel bis heute eine Gretchenfrage.
Im Schatten dieser Rezeptionskonjunktur erlebt auch der hegelianische Marxismus eine Renaissance, welche die beiden in enger Verbindung betrachtet. Wie sah Marx seinen Lehrer? Was hat er von Hegel übernommen, was abgelehnt und was bedeutet das heutzutage? Geht man mit Hegel über Marx hinaus oder mit Marx zu Hegel zurück? Diese Fragen könnte man als scholastisch-akademisch abtun, aber tatsächlich ist jede Hegel-Auslegung Ausdruck einer politischen Haltung. Denn allein in der Rechtsphilosophie wirft Hegel Probleme auf, die bislang ungelöst sind. Diese betreffen etwa Staat, Eigentum und Individualität in einer bürgerlichen Gesellschaft, in der das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis den Takt vorgibt. Hegels Philosophie ist somit ein »unentwickeltes Abbild« unserer Zeit, weil mit ihr Probleme zwar nicht praktisch gelöst, aber doch formuliert werden können, etwa wenn Hegel den Gegensatz von Armut und Reichtum als Schranke der bürgerlichen Gesellschaft darstellt.
Ein marxistischer Grafensohn
Der Marxismus hat in seiner Geschichte ein gespaltenes Verhältnis zum preußischen Professor entwickelt. Einerseits berufen sich Marxist*innen auf Hegels Dialektik, andererseits lehnen sie Teile seines Werks ab. In dieser Gemengelage hat der Grafensohn Galvano Della Volpe (1895–1968) die radikalste Position zu Hegel eingenommen. Sein Hauptwerk »Logik als historische Wissenschaft« liegt nun in deutscher Sprache vor. Das erstmals 1950 erschienene Werk wurde 1956 in überarbeiteter Form neu herausgegeben und erhielt 1969 in dritter Auflage seinen finalen Titel, nachdem die ersten beiden Auflagen unter dem Titel »Logik als positive Wissenschaft« erschienen waren. Alfred J. Noll hat das Werk nun mit einer umfangreichen biografischen und intellektuellen Einleitung versehen, es umfassend kontextualisiert, sorgsam übersetzt und mit eigenen Gedanken weitergeführt. Der italienische Philosoph Lucio Colletti bezeichnete 1969 in seinem Buch »Il marxismo e Hegel« die »Logik als historische Wissenschaft« als das »Wichtigste, was der europäische Marxismus in dieser Nachkriegszeit hervorgebracht hat«. Hierzulande ist der Autor allerdings kaum bekannt.
In Italien war Della Volpe auch zu Lebzeiten kein Unbekannter. Er hatte seit 1939 einen Lehrstuhl für Philosophiegeschichte an der Universität Messina inne, wandte sich 1944 dem Marxismus zu und trat sogar der Kommunistischen Partei Italiens bei – wo man ihn aber eher duldete, was auch an seiner adeligen Herkunft lag. Della Volpe versuchte, seine Position in Westeuropa, der Sowjetunion und der jungen DDR bekannt zu machen, blieb aber dennoch ein Außenseiter des europäischen Marxismus. Umso größer war sein Einfluss in Italien. Denn er war nicht nur derjenige, der die frühen Schriften von Marx in Italien bekannt machte, sondern auch einer der wenigen im Marxismus, die eine eigene Schule begründeten: den »Dellavolpismo«. Aus diesem gingen wiederum bedeutende Denker und Forscher wie Alessandro Mazzone und Nicolao Merker hervor, die trotz intensiver Bemühungen nie an westdeutschen Universitäten lehren durften, weil sie bekennende Kommunisten waren.
Della Volpe glaubt, in Hegels Philosophie eine rein zeitbedingte Theologie zu erkennen.
Schlägt man »Logik als historische Wissenschaft« auf und wühlt sich durch die Menge an teils redundanten, teils einfach ungewöhnlichen Formulierungen, mit denen Della Volpe seine Gedankengänge zu beschreiben versucht, dann wird schnell deutlich, warum er im deutschsprachigen Raum nie Bekanntheit erlangen konnte: Das Buch ist ein antihegelianisches Manifest. Della Volpe will Hegel aus dem Marxismus herauslösen, weil er in dessen Philosophie eine rein zeitbedingte Theologie zu erkennen glaubt. Er setzt Hegel eine »materialistische Theorie der Urteilskraft« entgegen. Jede Philosophie, die unabhängig von der Erfahrung der Menschen argumentiere und das, was außerhalb unseres Denkens existiere, nicht mit in ihre Überlegungen einbeziehe, sei fehlerhaft, verdorben und unfruchtbar. Das bedeute freilich nicht, dass der Weg, den Hegel einschlug, unbedeutend gewesen sei, sondern dass der Marxismus einen anderen Pfad zu beschreiten habe. Wirklich erfrischend sind die Bezüge, die Della Volpe herstellt, wenn er etwa Leibniz und Kant kritisiert, mit Aristoteles Platon zerpflückt und schließlich Galileis Forschungsmethode in höchsten Tönen lobt. Galilei verkörpere, so Della Volpe, ein wissenschaftliches Vorgehen, das sich dadurch auszeichne, dass die Analyse der Empirie einerseits durch die Beschreibung funktioneller Zusammenhänge – etwa mittels Mathematik – und andererseits durch die ständige Überprüfung der Hypothese im Experiment erfolge.
Ein undialektischer Materialismus
Die Welt ist demnach nicht Ausfluss eines »absoluten Geistes« und ihr Werden wird nicht von einem übersinnlichen dialektischen Widerspruch diktiert, dessen Existenz die Philosophie nur noch dogmatisch zu rechtfertigen hat. Vielmehr müsse die Wissenschaft von der Widerspruchsfreiheit ausgehen, denn man kann nicht bestimmte Eigenschaften einer Sache behaupten und im selben Moment bestreiten. Della Volpe geht sogar so weit zu behaupten, dass die Wirklichkeit insgesamt widerspruchsfrei strukturiert sei. Er knüpft die Erkenntnis der Dinge an die Sinnlichkeit und geht davon aus, dass die Welt eine »diskrete Einheit« ist, also aus voneinander unterschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, die durch die Vernunft vereinheitlicht und klassifiziert werden können. Allgemeine Eigenschaften können sich also immer nur in historischen Besonderheiten realisieren. Ein Beispiel aus der Biologie: Ein Baum ist dann ein Baum, wenn er durch bestimmte, voneinander unterschiedene Merkmale – etwa »verholzte Pflanze«, »Sprossachse« – bestimmt ist. Der Begriff Baum wird immer durch die Zergliederung und Verknüpfung der Merkmale gebildet, die als einzelne in ihrer Summe einen individuellen Baum ausmachen. Um unsere begriffliche Vorstellung zu überprüfen, überprüfen wir sie am individuellen, empirischen Baum, der ja auch eine Palme – »verholzte Pflanze«, »unverzweigt« – sein könnte.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Wissenschaftliches Vorgehen besteht laut Della Volpe also dann, wenn immer wieder der Kreislauf von Vernunft und Sinneswahrnehmung, von Deduktion und Induktion, von Gesetz und Phänomen, von Hypothese und Faktum praktisch-experimentell durchlaufen wird. Dies entspricht dem Vorgehen der Naturwissenschaften, und hier hat Theologie wahrlich keinen Platz. Problematisch am Ansatz ist aber, dass sich die materialistische Dialektik hier in der (vorläufigen) Definition von empirisch messbaren, sinnlich wahrnehmbaren Dingen und ihren Merkmalen erschöpft. Doch was ist mit Begriffen, die keinem empirisch-sinnlichen Ding direkt entsprechen, aber trotzdem Objektives beschreiben, wie Struktur oder Funktion? Und wie steht es um Dinge, denen wir einen bestimmten Sinn zuschreiben, etwa wenn wir eine Menschenmenge als Trubel wahrnehmen?
Gerade darin, dass es diese Fragen überhaupt aufwirft, liegt der aktuelle Wert des Buches. Denn sie richten sich letztlich an Sachprobleme statt an Gretchenfragen. Della Volpe zeigt, dass die Kritik der reinen Vernunft a priori kein sinnloses akademisches Unterfangen ist, sondern als integraler Bestandteil der Wissenschaft das Positive bewahrt, ohne in Positivismus zu verfallen, und das Negative negiert, ohne Hurra-Optimismus zu predigen. Denn wirklich denken kann nur, wer an eine konkrete Sache denkt und dabei ihre besonderen Merkmale herausarbeitet. Daher muss es der Wissenschaft – und davon ist der Marxismus nicht ausgenommen – immer darum gehen, eine bestimmte Sache erfahrbar zu machen, etwa indem sie die wahrnehmbaren Krisen auf die gegenwärtige Bewegung der kapitalistischen Produktionsweise zurückführt. Dies hat Bedeutung für die (Alltags-)Praxis: Nur das Wissen darüber, was eine Sache ausmacht, versetzt Menschen in die Lage, sie zu verändern.
Galvano Della Volpe: Logik als historische Wissenschaft. Übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Alfred J. Noll. Meiner Verlag für Philosophie 2024, 568 S., 78 Euro.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.