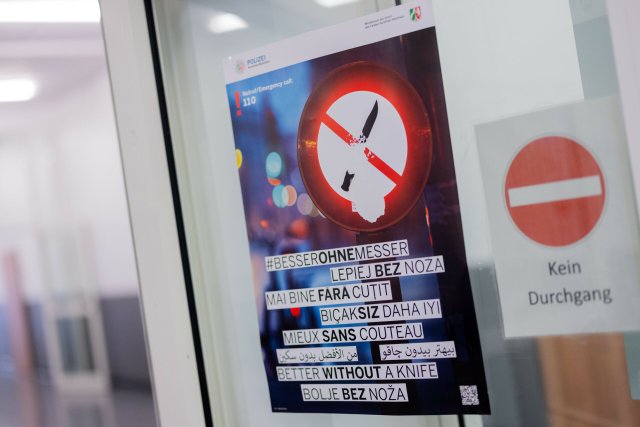- Kommentare
- Regierungskrise in Frankreich
Eine Lektion in Demokratie
Stephan Kaufmann über Frankreichs Regierungskrise und den kapitalistischen Nutzen geklärter Machtverhältnisse

In Frankreich steht die Regierung unter Premier Francois Bayrou vor dem Aus. Schon ist von einer »Krise der Demokratie« die Rede, die dieses Mal nicht irgendwelche Staaten in der Peripherie trifft, sondern ein kapitalistisches Kernland. Worin besteht die Krise?
Ausgangspunkt von Bayrous Problem sind die Schulden Frankreichs, die durch Finanz-, Corona- und Energiekrisen auf 114 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen sind. Um die Neuverschuldung zu senken, hatte der Premier ein harsches Sparpaket vorgelegt – unter anderem werden Sozialleistungen eingefroren und zwei Feiertage abgeschafft. Begründung Bayrous: »Unser Land ist in Gefahr, die Abhängigkeit von Schulden ist chronisch geworden.«
Problem Frankreichs sind aber nicht nur die aufgelaufenen Schulden, sondern vor allem die, die da noch kommen sollen. Denn wie die Bundesregierung, so will auch Paris seine massive Aufrüstung auf Kredit finanzieren. Um die Militärausgaben auf das Nato-Ziel von 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung zu hebeln, müsste sich der Verteidigungshaushalt bis 2035 verdoppeln. Das wäre schon machbar. Allerdings fürchtet die Regierung in Paris angesichts ihrer bereits hohen Schulden um die Gunst ihrer Kreditgeber, der Anleger an den Finanzmärkten, die vor drei Jahren bereits eine britische Regierung über ihre Ausgabenfreude stürzen ließen.

Stephan Kaufmann ist Wirtschaftsredakteur bei nd.DieWoche.
Damit die Anleger sich sicher fühlen und Paris weiter fleißig Geld leihen, will die Regierung an der Bevölkerung sparen. Bayrou macht also seinen Landsleuten die Rechnung auf, dass sie für den Erhalt der französischen Weltmacht Opfer bringen müssen, worauf diese Landsleute mit einer sympathisch geringen Opferbereitschaft reagieren: Für den 10. September sind Massendemonstrationen angekündigt. Wichtiger noch als der Unwille der Bevölkerung ist aber, dass auch die Opposition nicht mitzieht. Statt Bayrous Sparprogramm mitzutragen, dürften die anderen Parteien den Premier über seine Vertrauensfrage stürzen lassen. Eine eigene Mehrheit zum Durchregieren hat der Premier nicht. Fällt seine Regierung, muss Präsident Emmanuel Macron wohl die Nationalversammlung auflösen und Neuwahlen ausrichten. Aber auch die dürften die nötigen Mehrheiten nicht herstellen – die Elite ist sich schlicht zu uneins.
Die demokratische Wahl versagt der Politik also einen entscheidenden Dienst, nämlich eine eindeutige Ermächtigung der Regierung – eine Ermächtigung, durch die sie der Bevölkerung schmerzhafte Reformen einfach auferlegen könnte. Im erwünschten Normalfall bringt die Wahl eine Regierung an die Macht, die der Bevölkerung Opfer abverlangt, die sich die Bevölkerung dann als Ergebnis ihrer Wahl, also irgendwie ihres Willens zurecht legen kann.
In Frankreich dagegen ist derzeit kein Wahlergebnis absehbar, durch das die französische Regierung von der Stimmung der Bevölkerung oder den Launen der Opposition unabhängig würde. Und das beunruhigt die Finanzmärkte sehr. Denn sie lieben Macht, selbst wenn die dann verrückt spielt. In den USA eilen die Börsen von einem Rekord zum nächsten. Donald Trump mag diktatorische Neigungen haben. Für Anleger ist das aber immer noch besser als eine Regierung, die sich der Bevölkerung beugt. Das ist dann doch zu … demokratisch.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.