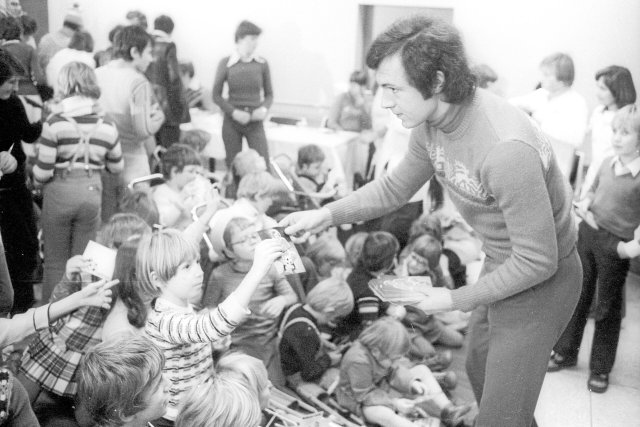- Kultur
- »Erbeuteter Reichtum«
Ökonom Heinz-J. Bontrup verlässt die Welt der Sekundärfragen
Die Akkumulation von Reichtum bei einigen wenigen nimmt immer bizarrere Formen an. Woher dies kommt, beantwortet das neue Buch von Heinz-J. Bontrup

Privates Eigentum bildet die Grundlage aller heutigen Gesellschaften. Gleichzeitig ist der Begriff schwammig: Eigentum an einem Kinderspielzeug kann ebenso gemeint sein wie die Mehrheit an einer Kapitalgesellschaft. Und er schert sich nicht darum, wer den (Mehr-)Wert geschaffen hat und ob Eigentümer ihren Besitz rechtmäßig erworben haben. Bedenklicherweise ist das Eigentum dennoch aus dem Blickfeld der meisten linken Bewegungen und Parteien geraten. Gestritten wird lieber über Sekundärfragen wie Steuertarife, Sozialleistungen oder Mietpreisbremse.
Die abstrakte Kategorie steht dagegen im Mittelpunkt des gerade erschienenen neuen Buches von Heinz-J. Bontrup. Genau 278-mal taucht das Wort »Eigentum« darin auf. In der Urgesellschaft war die vorherrschende Lebensform der Menschen noch kollektive Arbeit, schreibt der emeritierte Professor für Arbeitsökonomie an der Westfälischen Hochschule in Recklinghausen. Doch je mehr sich die Produktivkräfte arbeitsteilig entwickelten und schließlich ein Überschussprodukt kollektiver menschlicher Arbeit erwirtschaftet wurde, haben sich einige dieses mit brutaler Gewalt angeeignet. So entstand schließlich aus kollektivem das private Eigentum. Ein Aspekt, den Bontrup beim französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau ebenso entdeckt wie bei Adam Smith und bei Karl Marx.
Heute ist das akkumulierte Kapital ungleicher verteilt denn je. »Dem gigantischen konzentrierten Reichtum, der ökonomisch nur durch Ausbeutung erklärbar und nicht zu rechtfertigen ist, steht eine bittere Armut und Verschuldung gegenüber«, beklagt Bontrup, der lange Zeit in der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik aktiv und zeitweise ihr Sprecher war. Weltweit hätten heute die acht reichsten Männer so viel Eigentum angehäuft, wie eine Hälfte der Menschheit zusammen ihr Eigen nennt.
Solche bizarren Verhältnisse werden freilich auch von vielen Liberalen beklagt. Diese beantworten jedoch die Eigentumsfrage anders als Bontrup und setzen auf vermeintliche Chancengleichheit, womit dann »jeder seines Glückes Schmied« sei. Dabei stelle es einen Unterschied dar, so der Wirtschaftswissenschaftler, ob einer Person die Nutzungsrechte an einem Sofa oder seinen CDs rechtlich garantiert werden oder aber die Verfügung über Produktionsmittel, die andere Menschen benötigen, um sich selbst zu erhalten. Dieser Aspekt nehme an Bedeutung noch zu, wenn die Produktionsmittel nicht breit auf eine Vielzahl von Eigentümern verteilt sind – wie es der klassische Liberalismus vor Augen hatte –, sondern sich aufgrund der Akkumulation konzentrieren und zentralisieren. Diese Kritik zieht sich durch Bontrups ganze Schaffensperiode, der als Arbeitsdirektor in der Stahlindustrie auch »die da unten« kennenlernte.
In seinem Buch kommt er indes aucht nicht an Sekundärfragen wie der Mietpreisbremse vorbei. Sie löse nicht das Wohnungsmarktproblem, konstatiert er. »Politik muss die Ursache des Problems beseitigen. Und dies bedeutet, die Wohnungsknappheit mit öffentlich finanzierten und bereitgestellten Wohnungen zu beseitigen.« Dem stünden jedoch privatwirtschaftliche Profitinteressen von Wohnungseigentümern entgegen.
Letztlich verbindet Bontrup seine Überlegungen ähnlich wie sein französischer Kollege Thomas Piketty mit einer übergeordneten Zielvorstellung: Wenn das Kapitaleigentum nach streng egalitären Gesichtspunkten verteilt wäre und jeder abhängig Beschäftigte den gleichen Anteil an den Gewinnen zusätzlich zu seinem Lohn erhielte, würde die Frage des Verhältnisses zwischen Gewinnen und Löhnen (fast) niemanden interessieren.
Mit Blick auf die aktuellen Krisenreaktionen der Bundesregierung wünscht sich Bontrup, »dass nicht die Ärmsten sanktioniert werden, sondern die Vermögenden«. So drohe das Bürgergeld seine Funktion als existenzielle Grundsicherung zu verlieren und zum Steinbruch für die Finanzierung von Steuergeschenken zu werden. Derweil die Reichen von »ihrem erbeuteten Mehrwert« nichts zurückgeben müssten.
Unterm Strich belegt der Autor seine Befunde mit empirischen Ergebnissen aus über 30 Jahren Forschung. Und warnt in Essays und Interviews, von denen dieser Band eine stattliche Auswahl versammelt, vor wirtschaftspolitischen »Irrlehren«: Zunehmend zeige sich Marktradikalität in neoliberaler Zerstörung samt einem Millionenheer prekär Beschäftigter, bei massiven Ausgaben für Rüstung und Militär. Dem setzt der wortgewaltige Ökonom grundlegende Alternativen entgegen – insbesondere sein Lieblingskonzept für mehr Demokratie in der Wirtschaft.
Heinz-J. Bontrup: Erbeuteter Reichtum – Wege aus der neoliberalen Zerstörung, Papyrossa Verlag, Köln, 459 Seiten, 26,90 €.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.