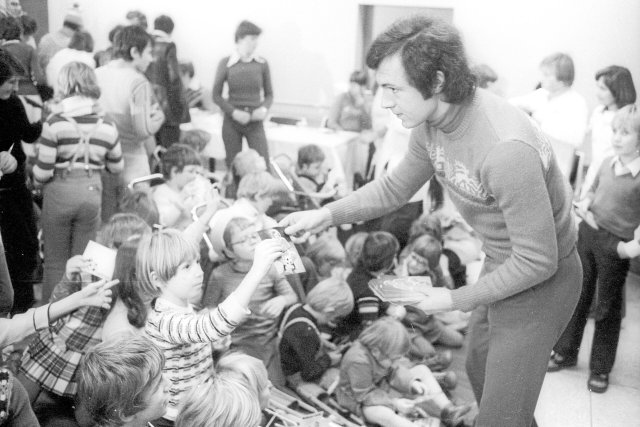- Kultur
- Picasso-Museum Málaga
Ein Lob den Frauen
Das Pablo-Picasso-Museum in Málaga offenbart Parallelitäten und Kontinuitäten

Ein Maler hat immer einen Vater und eine Mutter, kommt nicht aus dem Nirgendwo.» Mit diesen Worten bekennt sich Farah Atassi zu ihrem großen Vorbild Pablo Picasso. Der prägende Einfluss des spanischen Malers auf das Werk der 1981 in Brüssel – exakt hundert Jahre nach diesem – geborenen und – gleich diesem einst – in Paris lebenden Künstlerin mit syrischen Wurzeln ist unverkennbar. Kraftvolle und klare Konturen, konzentriert und pointiert. Mit Lust an Farblichkeit und Frohsinn, Sinnlichkeit und Stolz. Ihre Frauen präsentieren sich selbstbewusst, kokettieren mit dem Betrachter. Teils lasziv sich streckend, ihre Reize nicht versteckend, teils frech und provokativ, aber auch ernsthaft, in sich versunken, lesend, grübelnd.

Jeder weiß, dass Frauen im Leben von Picasso eine große Rolle spielten, als Geliebte und als Muse wie auch als Ehefrau und Haushälterin, als jene Kraft, die ihm Inspiration war, aber auch Freiheit zum Schaffen verschaffte. Das Picasso-Museum in Málaga erinnert daran mit einer im vergangenen Jahr eröffneten Exposition, der sich in diesem Frühjahr zwei Sonderausstellungen zugesellten, die einen Zeitgenossen und eine Nachgeborene vorstellen, deren Arbeiten viele Gemeinsamkeiten mit denen des berühmtesten Sohnes der andalusischen Metropole aufweisen: Óscar Domínguez und Farah Atassi. Parallelitäten und Kontinuitäten werden sichtbar.
Doch zunächst zu der dem großen Meister gewidmeten Schau «The Unity of a Life’s Work» (Die Einheit eines Lebenswerkes). Es sind hier bekannte und weniger bekannte Gemälde zu sehen. Beeindruckt steht man vor dem Monumentalgemälde «Les Demoiselles d’Avignon» von 1907, das die Ära des Kubismus einläutete. Nicht das südfranzösische Avignon ist hier gemeint, sondern das Carrer d’Avinyó, ein Rotlichtviertel in Barcelona, dessen Bordelle auch der junge Picasso aufsuchte. Zu sehen sind auch die vier wichtigsten Frauen in seinem Leben. 1917 lernte er die aus russischem Adel stammende Balletttänzerin Olga Kohhlova kennen, die er später auch heiratete. «Madre y niño» (Mutter und Kind) zeigt sie mit dem alsbald geborenen Sohn Paolo. Im Kontrast zu den noch naturalistisch gezeichneten «Drei Grazien» (Wahl und Qual des schönen Paris) ist sie in groben Pinselstrichen skizziert: Kräftige Arme umschlingen beschützend das Kleinkind. Der Vater muss auf den Sprössling sehr stolz gewesen sein, wie mehrere Porträts des Jungen bezeugen, mit weißer Mütze oder auf einem Esel reitend.
Dass Picasso ein Macho und Lüstling war, ist allgemein bekannt. Die Ehe mit Olga endete abrupt, als sie von Maya, seiner unehelichen Tochter mit dem französischen Modell Marie-Thérèse Walter erfuhr, hier als «Frau im Kleid mit grünen Kragen» zu erleben, 1938 auf Leinwand gebannt. Da hatte er bereits mit Dora Maar angebändelt, wie ein dieser gewidmetes, zwei Jahre zuvor entstandenes Ölgemälde, «Frau mit erhobenen Armen», verrät. Olga und Dora sollen sich um die Gunst des Meisters geprügelt haben. Die Neue gewann die Oberhand – bis auch sie abserviert wurde, 1943. Unbegreiflich, dass zwei talentierte, selbst beruflich erfolgreiche Frauen, die eine auf der Bühne, die andere als Fotografin und Malerin, sich derart narren ließen. Sie dürften dem Mann gewiss heftige Widerworte geliefert haben, indes zwecklos. Es ließ ihn unbeeindruckt in seiner HERRlichkeit.
Andererseits scheint er Respekt und vielleicht gar Furcht vor diesen Frauen empfunden zu haben. Dora Maar wird mit zu Berge stehenden Haaren, Fingern wie Tierkrallen und bösem Blick dargestellt. Ob sie so glücklich darüber war, wie sie auf dem Bildnis mit Katze in ihrer Körperlichkeit dekonstruiert, insbesondere ihr hübsches Gesicht derangiert ist, mag man bezweifeln. Picasso ist im Surrealismus angekommen. Destruktive Stilelemente, auch als Ausdruck der erlebten Schrecken seiner Zeit: der Franco-Putsch, das Morden in Spanien mit Deutschlands Waffenhilfe, Prolog des Zweiten Weltkrieges. Das zeitlose Antikriegsbild per se, «Guernica», entstand zu jener Zeit. Anklage des feigen Bombardements der deutschen Legion Condor auf die «heilige Stadt der Basken» am 26. April 1937.
Etwas ruhiger, in stringent-geometrischen Formen und multiperspektivisch die Porträts der folgenden Frauen an seiner Seite. Die 40 Jahre jüngere Marie Françoise Gilot, ebenfalls Malerin, 2023 in New York verstorben, Mutter des erfolgreichen Filmemachers Claude und seiner als Designerin nicht minder erfolgreichen Schwester Paloma, begegnet uns hier als «Mujer en un sillón» (Frau auf einem Sofa). Die letzte Lebensgefährtin und zweite Ehefrau, Jacqueline Roque, 46 Jahre jünger als Picasso, die sich nach seinem Tod 1973 mit ihrer Vorgängerin um das Erbe stritt, wurde von ihm am häufigsten porträtiert, vornehmlich seitlich.
Zur spanischen Avantgarde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte auch Óscar Domínguez. Der 1906 auf Teneriffa geborene und wie Picasso die meiste Lebenszeit in Paris verbringende Künstler wird im Obergeschoss des Palacio de Buenavista in Malaga, dem Domizil des 1997 gegründeten Picasso-Museums in Málaga, gewürdigt, wo auch die Arbeiten von Farah Atassi zu bewundern sind, die in den letzten zehn Jahren entstanden, einige 2024, noch fast farbfrisch.
Krach und Bruch. Menschliches, Allzumenschliches, auch den Künstlern nicht abhold.
-
Domínguez, dem im September 1936 dank falscher Papiere die Flucht vor den Franquisten nach Frankreich gelang und der sich nach dem Einmarsch der Wehrmacht in sein Exilland der Résistance anschloss, wird ebenso in seinen Wandlungen von figürlicher hin zu surrealistischer Bildsprache gezeigt. Frauen fehlen auch in seinem Werk nicht, ebenfalls als stolze, temperamentvolle, quirlige Frauen wie etwa «Madame», die einem Wirbelwind gleicht. Seine Arbeiten weisen viel Nähe zu Salvador Dalí auf. Und wie bei diesem und bei Picasso taucht als beliebtes Sujet der Stier auf. Übrigens: Picasso war mit Dalí eng befreundet, bis der exzentrische und für seinen Sarkasmus berühmt-berüchtigte Katalane sich über ein Gemälde des gebürtigen Andalusiers lustig machte. Krach und Bruch. Menschliches, Allzumenschliches, auch dem großen Dreigestirn der spanischen Moderne nicht abhold.
Wenn man in Málaga weilt, sollte man im Geburtshaus von Picasso vorbeischauen, unweit des Museums. Da gibt es nicht nur das authentische Mobiliar und Taufkleid des kleinen Pablo zu sehen, sondern ebenso Picassos legendäre «La Colombe», die Friedenstaube, entworfen für den Weltfriedenskongress in Paris 1949. Eigenartig, dieser historischen Zeichnung angesichts, ging der Besucherin hernach das DDR-Kinderlied «Kleine weiße Friedenstaube» nicht mehr aus dem Sinn, zumal ihr laufend in den Gassen der Altstadt von Malaga weiße Tauben vor die Füße und über den Kopf flatterten: «Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier/ dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir ...»
«Pablo Picasso: The Unity of a Life’s Work» bis 30.1. 2028; «Óscar Domínguez: Summer Workshops» bis 13.10. 2025; «Farah Atassi: Genius Loci» bis 14.12. 2025; Pablo-Picasso-Museum, Málaga, tägl. 10 bis 19 Uhr.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.