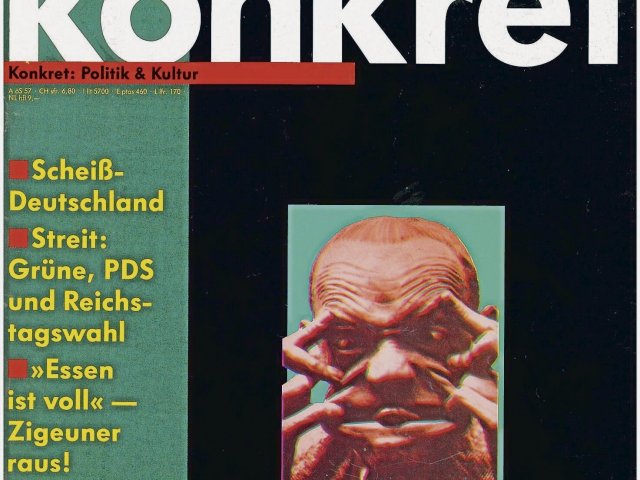- Kultur
- Kritische Gesellschaftsforschung
Immer noch im Interregnum?
Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung stritt auf ihrer Jahreskonferenz über »Umbrüche im globalen Kapitalismus«

In den Sitzreihen des Hörsaal II im Neuen Institutsgebäude der Universität Wien kamen dicht gedrängt rund 130 Teilnehmende zusammen. Viele von ihnen sind extra nach Wien angereist. Lukas Oberndorfer, Leiter der Abteilung Klima, Umwelt und Verkehr der Arbeiterkammer Wien, beginnt seinen Input auf dem Eröffnungspanel zum »neuen Gesicht des Autoritarismus« zur Jahreskonferenz der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG) mit einer Referenz auf den Film »Und täglich grüßt das Murmeltier« aus dem Jahr 1993. Dessen Protagonist Phil Connors, ein sarkastischer und zynischer Wettermoderator, gespielt von Bill Murray, hängt in einer Zeitschleife fest und muss den gleichen Tag immer wieder erleben. Ähnlich sieht es laut Oberndorfer mit der Weltlage aus: In vielen Gesellschaften seien seit nunmehr zehn Jahren Prozesse einer autoritären Formierung oder Tendenzen der Faschisierung zu beobachten. Die gesellschaftliche Linke versuche bisher vergebens, die Trendumkehr zu bewirken, und immer, wenn es scheine, als könne es schlimmer nicht werden, passiere die nächste Katastrophe.
Anschließend an den italienischen Marxisten Gramsci charakterisierte Oberndorfer die aktuellen Entwicklungen als »Interregnum«, als eine »Zwischenzeit«, die Mario Candeias jüngst als »Zeit der Monster« betitelte. Wie in den 1920er Jahren, als Gramsci diese Worte im Gefängnis schrieb, bestehe heute die Krise darin, »dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann«. Auf dem Podium zur Eröffnung der AkG-Tagung zum Thema »Multiple Krise, faschistische Tendenzen, imperialistische Konflikte: Umbrüche im globalen Kapitalismus« sind sich die Referent*innen über diese Zeitdiagnose nicht einig. Diese Uneinigkeit auf dem Podium durchzog nicht nur das Auftaktpodium, sondern die gesamte Konferenz.
So fragten etwa Dorothee Bohle, die zu Osteuropa forscht, und Margit Mayer, die die USA durch die widersprüchliche Trump-Koalition vor einer neuen Ära sieht, zurück, ob die Rede von einem »Dazwischen« noch angemessen sei. Benjamin Opratko wies im Hinblick auf die beinahe »Volkskanzlerschaft« des FPÖ-Politikers Herbert Kickl darauf hin, dass sich die Partei – spätestens seit der Ibiza-Affäre um den damaligen Vorsitzenden Heinz-Christian Strache, in deren Kontext Korruption noch prägendes Moment der Politik war – unter Kickl dahin entwickelt habe, durch Disruption den österreichischen Staat und seine Machtmittel einzusetzen, »um die Gesellschaft nachhaltig umzugestalten«.
Konjunktur der Abschottung
Marie Hoffman, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Marburg, versuchte im Workshop »Kritisch-materialistische Perspektiven auf die aktuelle europäische Migrationspolitik« den Begriff des »Interregnums« produktiv zu operationalisieren, der in mancherlei Aspekt in den letzten Jahren sicherlich zum Allgemeinplatz geworden ist. Dagegen schlägt Alexander Gallas, Professur an der Frankfurt University of Applied Sciences, vor, die aktuelle Konjunktur als »Subterranean Trumpism« zu charakterisieren. Seine These: Sowohl im Vereinigten Königreich unter der Labour-Regierung von Keir Starmer als auch in der Bundesrepublik mit dem CDU-Kanzler Friedrich Merz hält ein »verkappter Trumpismus« Einzug, der sich durch eine aktive Polarisierung und Anti-Linke-Rhetorik, einer Politik der Angst und des Spektakels kennzeichne. Hier werde die Rückerlangung von »Kontrolle« suggeriert, was sich nicht zuletzt an den rechtlich fraglichen Zurückweisungen an den deutschen Grenzen zeige.
Linke Intellektuelle verwenden immer weiter die gleichen Begrifflichkeiten zur Beschreibung der Gemengelage.
Auch die in der gesellschaftlichen Linken hochgradig konfliktgeladenen Themen sparte die AkG nicht aus. Beim ersten Teil des Workshops »Israel/Palästina, Antisemitismus, Rassismus und Staatsräson« referierten Michael Elm, Research Fellow am Minerva Institute für deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv, und Peter Ullrich, unter anderem Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Während Elm den Fokus auf die israelische Gesellschaft und die Auseinandersetzungen in ihr seit dem 7. Oktober legte, thematisierte Ullrich die widersprüchliche Konstellation eines »autoritären Anti-Antisemitismus«, der sich spätestens seit dem 7. Oktober in der Bundesrepublik abzeichnen würde. Zwar gäbe es auf beiden Seiten der Auseinandersetzung »binäre Freund-Feind-Schemata«, allerdings sei der »autoritäre Anti-Antisemitismus« eine hegemoniale gesellschaftliche Konstellation, die sich auf eine breite gesellschaftliche Koalition von rechts bis links stütze und sich unter anderem in einer repressiv-polizeilichen Bekämpfung von tatsächlichem und vermeintlichem Antisemitismus ausdrücke.
Bei all dem blieb die kontroverse Diskussion analytisch – die anvisierte Versachlichung gelang weitestgehend. Erst während des zweiten Abendpodiums, bei dem Andreas Bieler von der Gewerkschaft an seiner Universität in Nottingham im Vereinigten Königreich berichtet, die sich dafür einsetzt, die wissenschaftlichen Kooperationen mit israelischen Universitäten einzustellen, kommt es zu vereinzelten Zwischenrufen.
Solidaritätsstrukturen aufbauen
Neben der politischen Weltlage, materialistischen Methodendiskussionen, feministischer Theorie, kritischer Chinaforschung und vielen weiteren Themen stand auch die Reflexion von institutionellen Erfahrungen und kritischer wissenschaftlicher Praxen auf der Tagungsordnung. Dies gehört zum Selbstverständnis des Zusammenschlusses kritischer Wissenschaftler*innen, der sich 2004 mit dem Ziel gründete, die Diskussion über gesellschaftskritischer Theorieansätze voranzutreiben, vor allem aber »deren Reproduktion und Weiterentwicklung in Zeiten ihrer zunehmenden Marginalisierung an den Hochschulen« sichern wollte.
Dementsprechend ist damals wie heute die Frage, wie eine Institutionalisierung kritischer Wissenschaft gelingen kann, entscheidend für den Fortbestand einer kritischen Theorie der kapitalistischen Gesellschaft. Beim zweiten Abendpodium »Wissenschaft in Krisenzeiten: Konflikte, Strategien, Räume der Auseinandersetzung« diskutierten neben Ulrich Brand, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Wien, auch Andreas Bieler und Peter Ullrich sowie Carolina Vestena, die unter anderem aus Erfahrungen von Kolleg*innen in Brasilien unter Jair Bolsonaro berichtete und aktuell eine Professur in Kassel vertritt.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Um sich gegen Angriffe zu wehren – hier herrschte Einigkeit auf dem Abendpodium – müssen »Solidaritäts- oder Resilienzstrukturen« in der Wissenschaft geschaffen werden. Als Beispiele für die Bedrohungslage wurden etwa eine absolute Mehrheit der AfD auf Landesebene genannt, wie sie in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl 2026 drohe, sowie die Aktivitäten des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit oder rechte politische Kampagnen, wie sie zuletzt im Fall der »zentristischen Juristin« Frauke Brosius-Gersdorf geführt wurden. Hier seien klare Muster zu erkennen: Alles, was als »links« oder »woke« deklariert würde, stehe unter Verdacht und gerate unter Druck. Ullrich betonte trotzdem die Ambivalenzen und sprach sich gegen »linke Larmoyanz« aus: Auch wenn eine Tendenz der Faschisierung ausgemacht werden könne, helfe es nicht, nur die »Negativperspektive« zu betonen. Noch immer sei kritische Wissenschaft an Universitäten möglich.
»Und täglich grüßt das Murmeltier«
Im Film »Und täglich grüßt das Murmeltier« ändert die Hauptfigur ihr Verhalten, ist nett zu den Menschen und entkommt schließlich der Zeitschleife. Dass die gesellschaftliche Linke scheinbar aussichtslos gegen die Wiederkehr des Immergleichen kämpft, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch anders als der zynische Wettermoderator im Film verwenden linke Intellektuelle immer weiter die gleichen Begrifflichkeiten zur Beschreibung der gesellschaftlichen Gemengelage. Wer ab und an eine politisch-kritische (Wissenschafts-)Konferenz besucht hat, dem werden viele der Diskussion auf der diesjährigen AkG-Konferenz bekannt vorkommen. Neo-Gramscianische Perspektiven, also das Sprechen über die gegenwärtige Konstellation als »Interregnum«, prägen seit Jahren linke politische und wissenschaftliche Debatten. Und die seit der globalen Finanzkrise etablierte Begrifflichkeit der »multiplen Krise« wird auch erst seit Ende 2024 durch Begriffe wie »Faschisierung« oder »faschistische Dynamik« ergänzt.
Inwiefern diese gesellschaftstheoretischen Begriffe angemessen sind, um mit ihnen über das Bestehende hinausweisen zu können, ist offen. Widerspenstig sind Wissenspraktiken nur da, wo sie sich nicht einfach in die hegemoniale Ordnung einfügen, sondern diese infrage stellen oder sie unterlaufen können. Ob der Begriff »Interregnum« dies leistet, ist selbst diskussionswürdig. Deshalb sollte die wissenschaftliche Gegenöffentlichkeit, die die AkG seit nunmehr 21 Jahren für genau solche Fragen schafft, nicht geringeschätzt werden. Gerade angesichts der autoritären Formierung – wie auch immer man sie klassifiziert – und der Klimakrise, wird die Frage nach der Existenz derjenigen, die sich kritische Gesellschaftsforschung aneignen, ausarbeiten und weitervermitteln, von großer Wichtigkeit für soziale Kämpfe um Emanzipation bleiben. Hoffentlich hat diese Tradition eine Zukunft.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.