- Wirtschaft und Umwelt
- UN-Generalversammlung
Klimapläne mit großen Lücken
Staatentreffen in New York machte deutlich: 1,5-Grad-Ziel bleibt weiterhin unerreichbar

Es hätte ein Signal der Geschlossenheit werden sollen: Zum »Climate Ambition Summit« während der UN-Generalversammlung in New York waren alle 197 Vertragsstaaten des Pariser Weltklimaabkommens aufgerufen, ihre neuen Klimapläne, die sogenannten NDCs, vorzulegen. Diese geben Auskunft darüber, wie stark die Staaten ihre Treibhausgasemissionen bis 2035 senken wollen. Doch die Bilanz fällt ernüchternd aus: Nur ein Bruchteil der Staaten hat geliefert, bei den anderen bleibt die Ambition vielfach schwach – und das Zeitfenster zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels schließt sich.
Nach Angaben des UN-Klimasekretariats waren bis zur New Yorker Klimawoche lediglich 47 aktualisierte Pläne eingegangen. Im Februar, als die offizielle Deadline für die Vertragsstaaten eigentlich ablief, hatten gerade einmal 13 Länder ihre Beiträge eingereicht – darunter Brasilien als Gastgeber des bevorstehenden Klimagipfels, die Vereinigten Arabischen Emirate und Uruguay. Die meisten großen Emittenten blieben hingegen säumig.
Auch die zweite Deadline haben nun zentrale Akteure verfehlt: Weder China noch die EU oder Indien haben ihre neuen Ziele offiziell in das Register der UN-Klimakonvention eingestellt. Die USA steigen unter Präsident Donald Trump ohnehin ganz aus dem Paris-Abkommen aus.
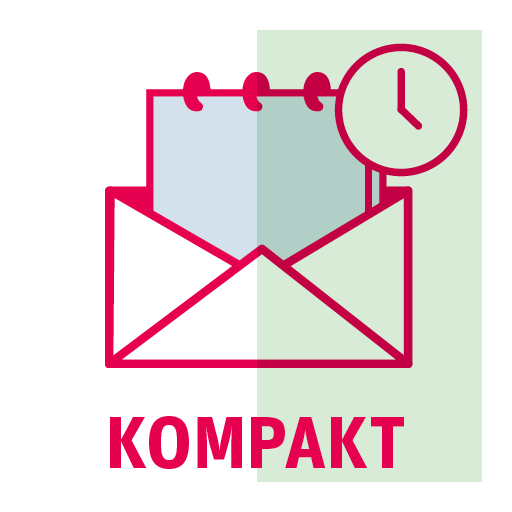
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
UN-Generalsekretär António Guterres forderte in New York, die Staaten müssten »viel weiter« gehen und »viel schneller« sein. Die NDCs seien nur glaubwürdig, wenn die Regierungen fossile Energien konsequent zurückdrängten und den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigten.
Der Klimagipfel COP 30 im November in Belém müsse mit einem »glaubwürdigen globalen Reaktionsplan« enden, um die weltweiten Bemühungen wieder auf Kurs zu bringen. Im Vorfeld der Generalversammlung warnte Guterres, das 1,5-Grad-Ziel sei »am Rande des Kollapses«.
Trotz des Drucks schieben viele Regierungen ihre Einreichungen hinaus. Zur Begründung heißt es etwa, man brauche mehr Zeit für interne Abstimmungen oder wolle wirksamere Pläne entwickeln. Klimabewegungen kritisieren jedoch, dass damit wertvolle Zeit verloren gehe. Ohne klare nationale Signale blieben Investitionen in erneuerbare Energien und die nötige Infrastruktur unsicher.
Für Schlagzeilen sorgte Chinas Präsident Xi Jinping, der vor wenigen Tagen per Videobotschaft ankündigte, die Emissionen seines Landes bis 2035 um 7 bis 10 Prozent unter den erwarteten Höchststand zu senken, der bis 2030 erreicht werden dürfte. Zwar begrüßten Beobachter, dass Peking erstmals ein absolutes Reduktionsziel für 2035 nennt. Doch die Unschärfen bleiben groß, denn weder das genaue Basisjahr noch konkrete Maßnahmen etwa beim Kohleausstieg wurden klar benannt.
»Scheitern ist nicht unvermeidlich. Es ist eine Entscheidung.«
Johan Rockström
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
Australien wiederum präsentierte während der Klimawoche am UN-Sitz einen neuen Plan, der eine Reduktion um 62 bis 70 Prozent im Vergleich zum Niveau von 2005 vorsieht. Damit bewegt sich Canberra im oberen Bereich dessen, was Fachleute bislang für realistisch hielten. Im Land selbst gibt es hingegen Kritik, die Regierung des sozialdemokratischen Premierministers Anthony Albanese kapituliere vor der fossilen Industrie.
Auch die EU deutete ehrgeizigere Zahlen an – eine Senkung um 66 bis 72 Prozent bis 2035 im Vergleich zu 1990. Formal beschlossen und eingereicht ist der Plan jedoch noch nicht. Vor der COP 30 im November solle er nun aber wirklich kommen, sicherten Brüsseler Vertreter in New York zu. Dies sei wichtig für die Glaubwürdigkeit Europas, lauteten dazu die mäßig mutmachenden Worte des deutschen Umweltministers Carsten Schneider (SPD). Es müsse ein starkes Ziel sein, das »unsere Wirtschaft auf den Weltmärkten der Zukunft nach vorne bringt«.
Brasiliens angekündigter Beitrag gilt als vergleichsweise ambitioniert, da er eine Wende bei der Amazonas-Entwaldung vorsieht. Doch gerade viele Staaten des Globalen Südens mahnen, ohne massive Klimafinanzierung und Technologietransfer ließen sich anspruchsvolle Ziele kaum erfüllen.
Die meisten Umweltorganisationen zeichnen auch nach den New Yorker Beratungen ein düsteres Bild. Nach ihren Einschätzungen werden die bislang vorliegenden Pläne noch immer zu einer Erwärmung von deutlich über zwei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts führen.
Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch begrüßte zwar die neuen, in New York vorgestellten Klimaziele als Rückenwind für den UN-Gipfel im November. Petter Lydén, zuständig für internationale Klimapolitik, schob allerdings nach, bisher handele es sich nur um eine »mäßige Brise«. Die neuen Klimapläne seien zwar erkennbar besser als die vorherigen, aber nach wie vor »deutlich entfernt von den Pariser Klimazielen«.
Das UN-Klimasekretariat will Ende Oktober einen Synthesebericht vorlegen, der alle bis dahin eingereichten NDCs bündelt. Er wird zum entscheidenden Prüfstein, ob die Weltgemeinschaft auf Kurs gebracht werden kann. Bei COP 30 geht es um Schlussfolgerungen daraus.
In New York trat in Gestalt von Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, schließlich noch die mahnende Stimme der Wissenschaft vor die Staatschefs und Minister*innen. Eine Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze in den nächsten fünf bis zehn Jahren sei kaum mehr abzuwenden, sagte er. Man habe gesagt, »Völker und Nationen vor den unkontrollierbaren Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels zu schützen«. Aber, hob der Wissenschaftler seine Stimme, bis zum Ende des Jahrhunderts müsse die Welt zu einem Temperaturplus von unter 1,5 Grad zurückkehren. »Scheitern ist nicht unvermeidlich. Es ist eine Entscheidung.«
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.







