- Politik
- Nato-Manöver
»Red Storm Bravo«: Konfetti statt Granaten
Der Hamburger Hafen war am Wochenende Schauplatz einer groß angelegten Nato-Übung – begleitet von Protesten und viel Symbolpolitik

Am ersten Tag der Nato-Übung »Red Storm Bravo« sitzt Kay Jäger in einem portugiesischen Café im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Vor ihm: ein aufgeklappter Laptop, daneben ein Becher Kaffee. »Der beste von ganz Hamburg«, sagt Jäger. Seit März dieses Jahres sitzt der 33-Jährige für die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, dem Landesparlament des Stadtstaats. Er ist aber auch Hafenarbeiter und Gewerkschafter bei Verdi. Natürlich beschäftigt ihn das, was im Hafen passiert – an diesem Wochenende und darüber hinaus.
Im Rahmen des Manövers »Red Storm Bravo« probt die Bundeswehr an zwei Tagen den Ernstfall. Das Szenario: Die Nato-Partnerländer im Baltikum werden von Russland angegriffen. Auf dem Programm stehen Truppenbewegungen vom Hafen durch Hamburg, die Niederschlagung von Protest, eine Drohnenshow und das Abtransportieren von Verletzten. Ungewöhnlich an der Übung ist die Verzahnung von Militärs mit ziviler Infrastruktur, so ist etwa die Arbeitsagentur Hamburg involviert.
Die soll im Ernstfall dafür sorgen, dass Beschäftigte zum Dienst in Bereiche abgestellt werden können, die für die Kriegswirtschaft wichtig sind. Grundlage für diesen möglichen Zwang ist das sogenannte Arbeitssicherstellungsgesetz, das Teil der 1968 erlassenen Notstandsgesetze ist. Bis heute hat es noch keine Anwendung gefunden.
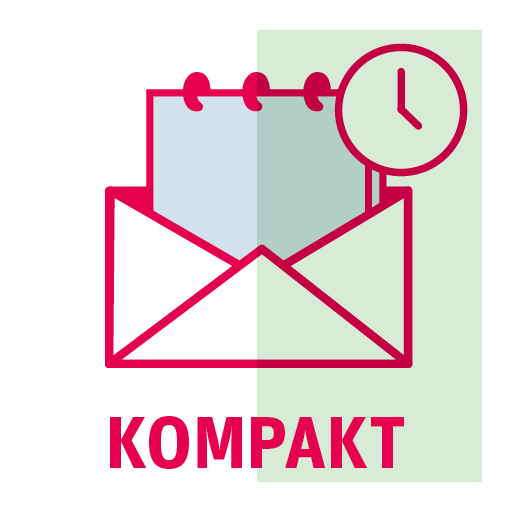
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Übung ist angelehnt an ein Szenario, das vor drei Jahren weit hergeholt geklungen hätte. Jetzt, im Herbst 2025, ist es zumindest im Bereich des Vorstellbaren: Über den Hamburger Hafen schickt die Nato Truppen nach Estland. Immerhin hat die estnische Regierung am 20. September wegen einer Bedrohungslage durch Russland nach Artikel 4 des Nordatlantikpaktes Konsultationen mit den anderen Nato-Mitgliedern beantragt. Auch Polen rief am 10. September unter Berufung auf Artikel 4 zu Gesprächen mit seinen Nato-Partnern. Zuvor waren bis zu 20 russische Drohnen in den Luftraum des Landes eingedrungen.
Im portugiesischen Café bringt der Besitzer Jäger einen Thunfischtoast. Ein Hering ziert seinen rechten Unterarm – tätowiert. In seiner Parteivorstellung steht, dass er gern Zeit an der Ostsee verbringt. Ein bisschen Klischee gehört eben dazu. Jäger bestellt einen weiteren Kaffee.
Wenn er spricht, dann mit voller Stimme und norddeutschem Einschlag. Mit seinen 1,90 Meter Körpergröße, dem blondem Vollbart und Seitenscheitel kauft man ihm den Hafenarbeiter ohne Weiteres ab. Schon sein Vater und Großvater arbeiteten dort, Jäger reiht sich mit 16 Jahren ein. Statt sein Abitur zu machen, beginnt er eine Ausbildung zur Fachkraft für Hafenlogistik. Mit heute 33, sagt er, stehe er nun schon sein halbes Leben lang im Hafen. Seit März ist er als Abgeordneter Teil der Bürgerschaft. Den Job im Hafen hat er aber nicht an den Nagel gehängt. Jäger bleibt Gewerkschafter und Hafenarbeiter. Fünf Schichten im Monat macht er neben seiner Abgeordnetentätigkeit.
Krieg und soziale Fragen
Beim Spaziergang durch Wilhelmsburg, dem Stadtteil, in dem Jäger wohnt, will er seine Kritik an Nato-Einsatz und Militarisierung nicht als moralische Position verstanden wissen. Als Linker sei er gegen den Krieg, sagt er, aber es gehe darum, in Zeiten von Deindustrialisierung auf die Lebensbedingungen der Arbeiter*innen in der Industrie zu schauen. »Wenn Beschäftigte vor der Wahl stehen, ob sie nun Waffen produzieren oder ihre Lebensgrundlage verlieren, hilft Moralisieren nicht weiter.«
Jäger zeigt in die Richtung, in der das Wilhelmsburger Krankenhaus Groß Sand steht, das für die medizinische Versorgung von 55 000 Einwohnern zuständig war. »Während Rheinmetall sich bei Blohm und Voss eingekauft hat«, das ist die Hamburger Traditionswerft, »wird gleichzeitig das einzige Krankenhaus weit und breit geschlossen«, moniert er.
Die Militärübung steht auch für einen grundlegenden Wandel, der im Hafen stattfindet. Erst im Mai hat der chinesische Staatskonzern Cosco 25 Prozent der Anteile an einem Container-Terminal des Hamburger Hafenbetreibers HHLA übernommen. Auch Rheinmetall wird künftig eine größere Rolle im Hafen spielen: Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, will in Hamburg nicht bloß Kriegsschiffe bauen. Mitte September ließ der Konzernchef verlauten: »Wir schaffen ein Powerhouse der Marine in Deutschland.« Rheinmetall will angesichts der günstigen Auftragslage massiv ausbauen und wolle bald 70 000 Menschen beschäftigen. Schon jetzt sind es weltweit rund 40 000.
In der Nacht auf Freitag hat die Militärkolonne Hamburg passiert. Einige gecastete Demonstrierende haben Blockadeversuche unternommen, die Fotos der Aktion wirken beinahe harmlos inszeniert: Man sieht Fotos einer Menschenkette, einer der Demonstrierenden hat ein Schild mit dem Wort »Kleber« umgehangen. Auf einem Foto einer weiteren Blockade der Kolonne steht auf einem weißen Tuch mit roter Farbe »Stop« geschrieben.
Von echtem Protest ist im Stadtbild bis dahin nicht viel zu sehen. An ein paar wenigen Orten haben Aktivist*innen Parolen wie »Nein zum Nato-Manöver« oder »Nein zum Krieg« gesprüht. Auf einer Kundgebung des Bündnisses »Kein Nato-Hafen« am Donnerstagabend beteiligten sich wenige hundert Menschen.
Bundeswehr-PR und Protest
Dafür ist die Pressestelle der Bundeswehr umso engagierter. Wer ihr schreibt, wird innerhalb weniger Minuten zurückgerufen. Aus dem Interesse der Medien an dem Manöver erhofft sich die Bundeswehr offenbar mehr Sympathie und Rückhalt in der Bevölkerung.
Am Freitag findet in der Bundeswehrkaserne eine »Leistungsschau Drohnenabwehr« statt. Auf 45 Presseplätze seien hundert Anfragen gekommen, sagt ein Oberleutnant am Telefon. Das Interesse an dem Manöver ist groß, befeuert durch beinahe tägliche Drohnensichtungen, zum Beispiel an Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und Aalborg.
Freitagabend am Hamburger Rathausmarkt. Etwa tausend Menschen sind zu einer Demonstration gegen das Manöver gekommen, im Laufe der Demo wächst der Aufzug auf etwa 1500 Teilnehmer*innen an. Auf einem Lautsprecherwagen spricht Özlem Demirel. Sie ist Abgeordnete für Die Linke im Europaparlament, dort ist sie im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung. Wenn sie redet, hat es fast etwas Pastorales: »Für uns gibt es keine Alternative, als den Widerstand gegen den Krieg zu üben. Und doch: Sie üben jetzt auch gleichzeitig, den Widerstand gegen den Krieg zu brechen«, sagt sie und spielt damit auf die Übung mit den Demonstrierenden am Vortag an.
Jäger ist ebenfalls vor Ort. Später tritt auch er ans Mikrofon. Lautstark betont er die Perfidie der Sparpolitik, deren Folgen Schulabgänger in die Arme der Bundeswehr treibt. Es ist ihm wichtig, Soldat*innen und Zivilgesellschaft nicht gegenüberzustellen, sondern die Versäumnisse des Sozialstaats zu betonen: »Als Linke müssen wir deutlich machen: Die Sparpolitik der letzten Jahre hat verhindert, dass die Infrastruktur überhaupt noch im ›Normalbetrieb‹ funktioniert. Das Geld ist da, es war nur falsch verteilt. Stattdessen redet man darüber, dass man dieses kaputt gesparte System jetzt kriegstauglich machen will.«
Die Demo läuft los. Mit einigen Freunden und Parteigenossen läuft auch Jäger mit, im Schlepptau hat er den Bollerwagen seiner Partei, darin Megafon, Fahnen und Plakate. Parolen wie »An jedem Krieg, in jedem Land, verdient am Schluss die Deutsche Bank« oder »Viva, viva Palästina« werden gerufen.
In einem Block laufen etwa hundert junge Demonstrierende unter einem Banner mit der Inschrift »Nein zu Sozialabbau, Aufrüstung und Krieg«. Eine von ihnen ist Janne. Sie ist 24, macht eine Ausbildung zur Erzieherin und engagiert sich beim Offenen Antifa-Treffen in Hamburg. Was ist ihre Motivation, auf die Demo zu gehen? »Gestern sind fünf Kampfjets der Bundeswehr über meinen Kopf geflogen. Ich stand alleine am Busbahnhof, da habe ich mich schon ziemlich hilflos gefühlt, weil ich weiß, die Proben gerade den Krieg«.
Gegen diese Ohnmacht, sagt sie, helfe Organisierung, aber eben auch solche Demos. »Der Großteil der Bevölkerung ist gegen den Krieg. Hier merkt man, dass man nicht allein damit ist.« Als die Veranstaltung fast an ihrem Ende angekommen ist, lässt ein junger Aktivist an einer Brücke im Hafen einen Panzer aus Pappe herunter. Eine Fahnenstange schlägt nach ihm, der Papppanzer zerbricht unter dem Gejohle der Menge. Aus seinem Inneren kommen keine Granaten, dafür Konfetti.
»Wenn Beschäftigte vor der Wahl stehen, ob sie nun Waffen produzieren oder ihre Lebensgrundlage verlieren, hilft Moralisieren nicht weiter.«
Kay Jäger Abgeordneter der Linken in der Hamburger Bürgerschaft
Nach dem Wochenende wird man in Zeitungen von der Freundlichkeit und Offenheit lesen können, mit der Soldat*innen der Bundeswehr in Hamburg begrüßt worden seien. Das ist ein Teil der Wahrheit. Die Spannungen mit Russland haben manche Bürger*innen verängstigt und sie bewusst werden lassen, dass es Schutz durch eine funktionierende Bundeswehr geben sollte. Aber es gibt auch Menschen, die es anders sehen.
Am Samstag, dem letzten Tag der Übung, donnern Bundeswehr-Hubschrauber in niedriger Höhe über den Hafen. Unter ihnen wird ein »Massenanfall von Verletzten« simuliert. Eine Radfahrerin hält an, blickt nach oben und fragt den Reporter: »Sind die vom Militär?« Als sie die Bestätigung bekommt, sagt sie nur »krass« – aber nicht so, als fände sie das beeindruckend. Eher so, als hoffe sie, dass solche Bilder nicht zur Gewohnheit werden.
Kay Jäger steht vor dem Eingang des Hafenbetreibers HHLA und nimmt mit einem Pressemitarbeiter der Partei ein Video auf. Mit anderen Abgeordneten zusammen hat er der Übung beigewohnt. Nachdem die Szene im Kasten ist, steigt er in seinen Bus. Gerade will er los, da sieht er seinen Vater auf dem E-Bike. Aus Buchholz in der Nordheide ist er nach Hamburg gefahren, zum Heimspiel des FC St. Pauli. In norddeutschem Schnack wechseln sie ein paar Worte, zum Abschied sagt er zu seinem Vater: »Iss ’ne Wurst für mich mit«. Dann setzt er sich in den Bus und fährt in seinen Feierabend. Raus aus dem Hafen, über dem noch immer die Rotorblätter der Helikopter kreisen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







