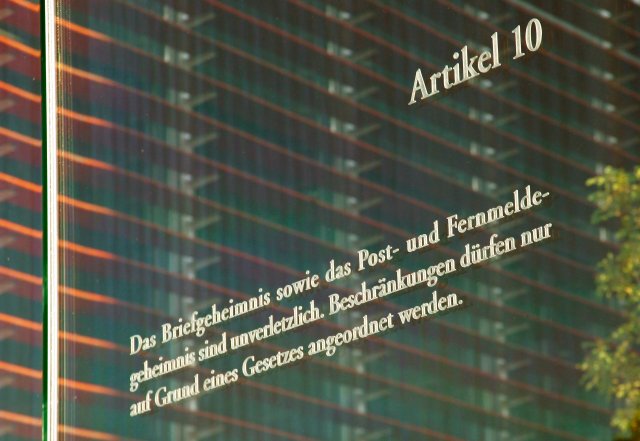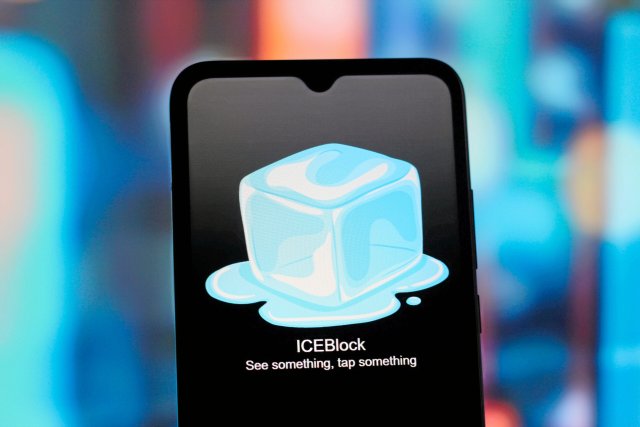- Politik
- Kinder in Palästina
»Nie hat mich ein Thema so erschüttert«
Die Soziologin Doris Bühler-Niederberger erforscht das Leid palästinensischer Kinder über Generationen hinweg

Sie haben den Band »Palästinensische Kindheit und Jugend« herausgegeben. Wie ist es dazu gekommen?
Mein Kollege Manfred Liebel hat den Anstoß gegeben, und für seinen Mut bin ich ihm sehr dankbar. Für mich war es eine Erleichterung einzusteigen – ich hatte schon vorher versucht, mich zum Krieg in Gaza zu äußern, war aber bei deutschen Fachzeitschriften sofort auf Granit gestoßen. Zu jener Zeit war es gerade bei diesen unmöglich, etwas zum Thema Palästina zu platzieren. Das Buch war für uns daher auch eine Möglichkeit, die wissenschaftliche Sprachlosigkeit zu durchbrechen.
Haben Sie sich bereits vorher akademisch mit dem Thema beschäftigt?
Ich habe mich mein gesamtes Forscherinnenleben mit Kindheit beschäftigt: mit den Positionen von Kindern in der Gesellschaft, mit Anerkennung, Ungleichheit und Rechten. Von dort ist der Schritt nicht weit: Wenn Tausende Kinder getötet werden, kann man als Kindheitsforscherin nicht schweigen. Schon im Oktober 2023 war klar, dass in Gaza in erschreckender Geschwindigkeit Tausende Kinder getötet werden. Spätestens da war Schweigen für mich gleichbedeutend mit Komplizenschaft. Ich habe mir im Nachhinein sogar Vorwürfe gemacht, mich nicht schon früher systematisch mit der Region beschäftigt zu haben. In Asien habe ich seit Jahrzehnten geforscht, zu Westasien aber kaum.

Doris Bühler-Niederberger ist Expertin auf dem Gebiet der Kindheitsforschung. Sie ist emeritierte Professorin für Soziologie der Universität Wuppertal und ehemalige Präsidentin der Forschungskommission »Soziologie der Kindheit« der Internationalen Gesellschaft für Soziologie (ISA). Gemeinsam mit Manfred Liebel hat sie den Band »Palästinensische Kindheit und Jugend« herausgegeben. Im Interview spricht sie über die wissenschaftliche Sprachlosigkeit zum Thema Palästina in Deutschland, über Gewalt- und Traumataerfahrungen, die sich durch Generationen palästinensischer Kinder ziehen, und über die Gefahr, wenn Kinder im Konflikt politisch instrumentalisiert werden.
Hat das Buch auch einen aktivistischen Anspruch oder ist es rein akademisch?
Wir haben die Sprache bewusst differenziert gehalten, aber natürlich ist schon die Entscheidung, palästinensische Kindheit ins Zentrum zu rücken, eine politische. Gleichzeitig ist es Wissenschaft: Wir übersetzen, kontextualisieren, dokumentieren. Dass manche das als »Aktivismus« abtun, liegt vor allem daran, dass ihnen die Ergebnisse nicht gefallen. Ich finde, dass alle Informationen, die man nach bestem Wissen und Gewissen zusammenträgt und so aufbereitet, dass die Leser*innen sich selbst ein Bild machen und die genannten Quellen einsehen können, Wissenschaft sind – auch wenn sie die brisanteste Wahrheit enthalten.
Wie sind Sie das Thema angegangen?
Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. In den ersten beiden übersetzen wir zentrale Texte internationaler Kolleg*innen, etwa von Nadera Shalhoub-Kevorkian, Hedi Viterbo und Timea Spitka. In den jeweiligen Einleitungen kontextualisieren wir diese Texte mit Informationen zur geschichtlichen Entwicklung und aktuellen Situation und stützen uns dabei auf Historiker*innen, manche von ihnen israelisch. Im dritten Teil haben wir eigenes Material gesammelt: lebensgeschichtliche Interviews mit Menschen, die in Palästina aufgewachsen sind – sei es im Westjordanland, in Gaza oder im heutigen Israel. Diese Erzählungen beginnen meist mit der Familiengeschichte, rekonstruieren die Kindheit und enden mit einem Ausblick in die Zukunft. So wird sichtbar, wie strukturell begrenzt und von Gewalt überschattet palästinensisches Leben ist – und zugleich, welche Vielfalt und Stärke darin steckt.
Wie äußert sich Letzteres?
Was ich in den Erzählungen der Kinder sehe, ist eine existenzielle Notwendigkeit, die eigenen Bedürfnisse und die eigene Würde zu verteidigen. Das reicht von sehr kleinen Gesten bis hin zu wagemutigem Ungehorsam. Ein Mädchen erzählte, dass es nicht mehr in den Kindergarten ging, weil beim Nachbarsjungen nach einem Abriss des Wohnhauses alle Spielsachen verschwunden waren. Sie sagte: »Das passiert mir nicht, ich bleibe, wenn die Bulldozer kommen, und rette meine Spielsachen.« Ein anderes Mädchen ging trotz Ausgangssperre in den Garten, um zu spielen. Für sie war das kein Leichtsinn, sondern der Ausdruck: Ich will Kind sein, ich will frei sein. Das ist eine Verteidigung von Bedürfnissen und Würde.

Viele verbinden Palästina mit Geopolitik und Krieg. Was sagt speziell der Blick auf Kindheit und Jugend, um die Realität dort besser zu verstehen?
Kinder machen fast die Hälfte der Bevölkerung aus – in Gaza sind es 49 Prozent. Eine Gesellschaft ohne Kinderforschung zu betrachten, würde vieles ausblenden. Dann kommt noch etwas Prinzipielles dazu. Man erkennt, wenn man die Kinder studiert, noch einmal deutlicher die Ohnmacht, aber auch den Mut der Betroffenen. Kinder sind manchmal, wenn sie in einer Situation der Gewalt sind, fast selbstmörderisch mutig. Dieser Mut ist die Möglichkeit, sich selbst zu bewahren. Wenn man Kinder erforscht, erkennt man außerdem, wie Hass funktioniert, denn diese Kinder und Jugendlichen werden sogar zu Feinden erklärt. In israelischen und westlichen Medien werden sie oft schon als kleine Kämpfer dargestellt. Auch Kinder zu kriegen, wird ihren Eltern als eine Art Kriegswaffe ausgelegt. Diese Dehumanisierung prägt den Konflikt grundlegend.
Ziehen sich bestimmte Muster von Gewalt durch die Generationen der Palästinenser*innen?
Ja, viele Erzählungen sind austauschbar zwischen Großeltern und Enkeln: Vertreibung, Hausabrisse, Bombardierungen. Kinder, die heute elf Jahre alt sind, haben oft schon drei oder vier große Militäroperationen erlebt. Die Traumata pflanzen sich fort. Ich habe mir vorgestellt, wie im Jahr 2100 die heute Überlebenden ihren Enkeln von zerstörten Häusern und getöteten Geschwistern erzählen werden – so, wie sie selbst schon von der Großmutter solche Geschichten gehört haben. Gewalt hat eine erschreckend lange Halbwertszeit. Es gab kein Interview, in dem nicht geweint wurde. Es ist schon sehr hart, was diese Menschen durchmachen. Die Welt ist auch für mich eine andere, seitdem ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich habe mich schon mit vielen schwierigen Themen beschäftigt: Heimkinder, misshandelte Kinder. Ich habe jedoch nie ein Thema gehabt wie jetzt, das mich so erschüttert hat.
Romantisiert man Kinder, wenn man sie zu Trägern der Hoffnung eines Friedens in der Zukunft macht?
Ja, vor allem entlastet man sich selbst, und zwar zu Unrecht. Wir haben unseren Mist zu erledigen, sei es das Klima oder seien es die politischen Konflikte – und nicht die Kinder. Wenn sie Kinder zusammensetzen, dann werden sie wahrscheinlich relativ schnell miteinander spielen. Aber wenn sie Erwachsene werden, werden sie in den Strukturen stehen, in die wir sie gestellt haben. Wir müssen diese Strukturen ändern, bevor die Kinder darin aufwachsen und sie reproduzieren. Frieden ist Aufgabe der Erwachsenen. Kinder wollen spielen, lernen, leben. Wenn wir ihre Rechte ernst nehmen, müssen wir ihnen diesen Raum eröffnen, statt sie ständig in die Rolle künftiger Kämpfer oder Opfer zu drängen. Israel und auch die Hamas oder andere Gruppen vereinnahmen Kinder. Das ist fatal.
Schon im Jahr 2011 erschien ein beeindruckendes Manifest der Jugend von Gaza für einen Wandel: »Gaza Youth Breaks Out«. Darin hieß es: »Scheiß auf die Hamas! Scheiß auf Israel! Scheiß auf Fatah! Scheiß auf die UN! Scheiß auf die UNRWA! Scheiß auf die USA! Wir, die Jugend in Gaza, haben die Nase voll.«

Ja, das ist etwas, das wir als Jugendliche wohl auch hätten schreiben können – wenn auch nicht aus derselben Verzweiflung. Es ist das jugendliche Bewusstsein: Wir verlassen uns nicht mehr darauf, dass andere unsere Probleme lösen, denn das tun sie ohnehin nicht. Stattdessen möchten wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Gleichzeitig ist es frustrierend und tragisch: Jugendliche wollen sich einerseits von der Brutalität Israels befreien, erleben aber andererseits, dass ihr Jugendzentrum von der Hamas zerstört wird, weil sie gegen deren Regeln verstoßen. Ich weiß nicht, wo diese Jugendlichen heute sind, die vor einigen Jahren dieses Manifest geschrieben haben.
Kinder nehmen im Diskurs eine besondere Stellung ein: Palästinasolidarische Stimmen verweisen auf ihre Tötung, israelsolidarische hingegen setzen diese Erzählungen mit der Kindermord-Legende des mittelalterlichen Antijudaismus gleich. Gleichzeitig werden palästinensische Kinder in israelischer Propaganda als radikalisierte und daher legitime Ziele dargestellt. Wie kommen wir dahin, Kinder in Gaza einfach als Kinder zu sehen?
Indem wir sie nicht länger instrumentalisieren. Ein Kind hat Rechte, egal, wer es verletzt – ob israelische, palästinensische oder andere Akteure. Es darf keinen Unterschied machen. Wir kennen in Deutschland die Namen und Gesichter der israelischen Kinder, die am 7. Oktober getötet wurden. Von den inzwischen über 20 000 getöteten Kindern in Gaza kennt man kaum einen Namen – vielleicht Hind Rajab, weil es dazu einen Film gibt. Aber jedes dieser Kinder verdient die gleiche Aufmerksamkeit und Anteilnahme.
Sie selbst wurden in diesem Kontext auch bereits scharf angegriffen, so in der »Bild« und der »Jüdischen Allgemeinen«. Wie sind Sie damit umgegangen?
Natürlich war das belastend. Besonders, weil nicht nur Medien, sondern auch Kolleg*innen diese Vorwürfe aufgegriffen haben. Manche warfen mir Antisemitismus vor, ohne überhaupt auf meine Argumente einzugehen. Oft ging es eher um ihre eigene Gefühlswelt als um das, was ich geschrieben hatte. Das wurde mir erst im Nachhinein richtig bewusst. Inzwischen haben sich manche wieder freundlich gezeigt oder gar nicht mehr über das Thema gesprochen. Entschuldigt hat sich niemand. Aber: Man lernt, damit umzugehen. Neue Solidaritäten entstehen. Da ich Kinder erforsche, thematisiert meine Kritik nun einmal primär die Tötung von Kindern durch Israel. Dass viele darauf eine Verbindung zu antisemitischen Narrativen projizieren, liegt weder in meiner Verantwortung noch Intention. Für mich bleibt entscheidend: Wissenschaft muss auch das aussprechen dürfen, was unbequem ist.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.