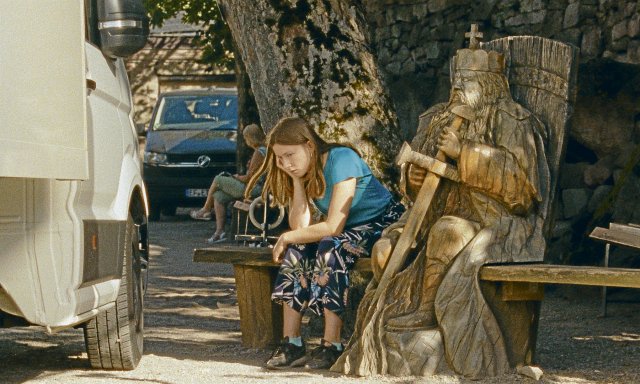- Kultur
- Frankfurter Buchmesse
Großer Wurf ganz klein: der neue Pynchon
Thomas Pynchons neuer Roman »Schattennummer« erzählt von einer verrückten Welt am Vorabend des Faschismus

Kaum ein Buch dürfte in diesem Herbst mit größerer Spannung erwartet worden sein als Thomas Pynchons neuer Roman »Schattennummer«. Das liegt nicht nur am geheimnisumwitterten Autor, an dem Kultcharakter seiner Bücher und der literaturgeschichtlichen Bedeutung seines Werkes. Vielmehr geht es um die Frage: Was hat einer der wichtigsten US-amerikanischen Autoren unserer Zeit, der in seinem letzten Roman »Bleeding Edge« (2013) eindrücklich vor Autoritarismus und Faschismus in Amerika warnte, zu unserer Gegenwart zu sagen?
Leider oder auch zum Glück fehlt eine klare, allzu einfache derartige Botschaft auf diesen 400 Seiten mitreißender Prosa voll unzähliger Akteure, jeder Menge einander überlagernder Handlungsstränge und Nebenschauplätze. Es gibt kriminelle Machenschaften zu bewundern, revolutionäre Hoffnungen und Verschwörungen, die ganze Kontinente umfassen. Angereichert mit historischen Mythen, ein wenig Zauberei, Jazz- und Klezmer-Musik sowie hingebungsvoll getanztem Lindy Hop. Immerhin, und das lässt sich dann doch durchaus als simple und verstörende Botschaft lesen, ist dieser Roman im Jahr 1932, also am Vorabend des historischen Hitler-Faschismus angesiedelt.
Der Hauptplot ist wie immer rasch erzählt. Ein Privatdetektiv namens Hicks MacTaggart aus Milwaukee, der früher als Schläger für die Industriebosse Streikende verprügelte, mittlerweile aber geläutert ist, soll die junge Daphne Airmont, Erbin eines Wisconsiner Käseimperiums, wieder nach Hause bringen, nachdem sie mit Hop Wingdale, dem Klarinette spielenden Musiker einer Klezmer-Band durchgebrannt ist. Von Milwaukee geht es nach New York, wo Hicks irgendwann das Bewusstsein verliert und sich auf einem Dampfer Richtung Europa wiederfindet, wohin sich auch Daphne mit den Klezmopolitans abgesetzt hat. Komplizierter wird es, wenn es um die Frage geht, warum Hicks den Auftrag bekommen und seine Heimatstadt verlassen hat.
Zum einen nimmt ihn das FBI in die Mangel, das ihn rekrutieren will, um Nazis zu jagen, von denen es im von deutschen Einwanderern dominierten Milwaukee ziemlich viele gibt und die begeistert von Hitler schwärmen. Einige Gangster machen ihn für den Sprengstoffanschlag auf einen Lastwagen mit geschmuggeltem Schnaps verantwortlich (wir befinden uns nicht nur mitten in der Weltwirtschaftskrise, sondern auch am Ende der Prohibition). Außerdem hatte der junge Detektiv Hicks vor Jahren ein kurzes Techtelmechtel mit der Käseerbin, als er sie eines Nachts im Schnellboot über den Lake Michigan fuhr, nachdem sie aus einer psychiatrischen Klinik in ein indigenes Reservat geflohen war.
Thomas Pynchons insgesamt neun Romane lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen. Zum einen sind da die großen Würfe wie »V«, »Die Enden der Parabel«, »Mason und Dixon«, »Gegen den Tag« oder »Bleeding Edge«: voluminöse Bücher, die als Meilensteine der postmodernen Literatur gelten.
In diesen rückt er den großen Themen unserer Zeit zu Leibe, um sie in welterklärende Erzählungen zu gießen, die aber stets im Chaos ihrer Nebenschauplätze ins Unendliche ausfransen und genau darin ihre ureigene Genialität entwickeln. Es geht um nicht weniger als Kapitalismus, Faschismus, Kolonialismus, Wissenschaftsgeschichte, um Fetischismus und Raketen, um Todessehnsucht und technologischen Wandel, aber auch um 9/11 oder anarchistischen Widerstand.
Diesen großen Würfen stehen die kleineren, meist kürzeren Romane gegenüber, wie »Die Versteigerung von Nr. 49«, die kalifornische Detektivgeschichte »Inherent Vice« oder der Hippieroman »Vineland«, der für den gerade erst ins Kino gekommenen Film »One Battle After Another« Pate stand. Regisseur Paul Thomas Anderson hatte auch schon »Inherent Vice« als Film adaptiert. Auf »Vineland« mussten Pynchons Fans nach »Die Enden der Parabel« ganze 17 Jahre warten. Viele waren enttäuscht; David Foster Wallace schimpfte in einem Brief an Jonathan Franzen: »Ich habe das starke Gefühl, dass er 20 Jahre damit verbracht hat, Pot zu rauchen und fernzusehen.«
Wo ist nun »Schattennummer« einzuordnen? Das Buch gehört der Länge nach mit 400 Seiten eher zu den kurzen Romanen, sodass in Blogs und Foren von Fans schon gemutmaßt wurde, der große Wurf stehe erst noch bevor. Das ist aber bei einem Autor, der jetzt 88 Jahre alt ist, nicht gerade wahrscheinlich. Und thematisch wie motivisch ist »Schattennummer« ein Buch, das nicht alle, aber viele wichtige Themen aus Pynchons Literatur in sich vereint und in ein rasantes literarisches Sujet überführt. Denn Hicks jagt Daphne durch ganz Europa nach. Es geht von Wien über Budapest nach Transsilvanien, an die kroatische Adriaküste. Dabei bewegen sich die stets eigenwillige Namen tragenden pynchonesken Personen mit U-Booten, Tragschraubern, also kleinen Minihubschraubern, Zeppelinen und Motorrädern durch die Landschaften.
Auf einer »Trans Trianon 2000«-Tour heizen Hunderte von Motorradfahrern durch Osteuropa. Die Geheimdienste sind immer dabei, der britische ebenso wie der deutsche und der österreichisch-ungarische; Mafiosi jagen durch dieses Europa am Vorabend des Faschismus, der sich überall bemerkbar macht in Form von saufenden SA-Schergen über ungarische Faschisten bis hin zu transsilvanischen Antisemiten. Mittendrin steckt Hicks, der den Konzerten der Klezmopolitans folgt. Daphne wiederum sucht ihren Geliebten. Ihr im Untergrund lebender Vater Bruno Airmont, »Al Capone des Käses« genannt, treibt sich ebenfalls in Europa herum.
Wie in seinen großen Romanen packt Pynchon die gerade mal 400 Seiten dieses comicartigen literarischen Universums bis zum Rand voll mit eigenwilligen Charakteren. Ace Lomax fährt in geheimer Mission für das Airmont’sche Käseimperium mit der Harley durch ungarische Wälder, Zoltan von Kiss lässt Dinge verschwinden und plötzlich wieder erscheinen, Stuffy Keegan steuert ein österreichisch-ungarisches U-Boot durch den Lake Michigan, später durch die Adria, und auch ein Golem wandert durch diesen Roman voller Musik, Tanz und Melodien mit schrägen Texten.
Hicks bekommt es mit unzähligen Agenten und Verschwörern zu tun, verhandelt irgendwann auch mit Daphne, die sich sogar bereit erklärt, nach Amerika zurückzufahren, aber keinesfalls so mir nichts, dir nichts das Käseimperium erben will. Nebenbei wird noch über den Markt für gefälschten Käse und die Unterdrückung der Milchbauern gefachsimpelt.
Immer wieder verliert oder findet sich diese Prosa in ausufernden Beschreibungen des Europas der früher 30er Jahre als psychedelisches Panoptikum. »Abtrünnige Nonnen in Zivilklamotten tanzen Two-Step mit bombenwerfenden marxistischen Guerilleros. Tollkühne faschistische Piloten spielen Poker mit Veteranen der Yangtse-Patrouille, die glauben, dass Flugzeuge nur dazu gut sind, abgeschossen zu werden. Wagner-Soprane lernen die Hillbilly-Akkorde von Wabash Cannonball. Piraten besaufen sich mit Seetransport-Versicherungsvertretern.«
Diese pynchoneske Welt, die bei der Jagd durch Mitteleuropa sehr an Tyrone Slothrops langen Weg durch die Nachkriegszone in »Die Enden der Parabel« erinnert, mündet am Ende im Exil, das Hicks in Europa antritt. Eher am Rande wird dann noch erwähnt, dass Präsident Roosevelt von General McArthur und einer Handvoll Millionäre gestürzt wurde. Ein Militärputsch in den USA? Wo Nebenschauplätze beginnen und der Hauptplot endet, das war nie unklarer als in diesem rasanten Roman.
Ganz am Schluss steht eine Fahrt nach Westen, nach Kalifornien, ganz eskapistisch, nur möglichst weit weg vom Faschismus, der in diesem Buch über Umwege dann doch fast alles zu durchdringen scheint.
Thomas Pynchon: Schattennummer. A. d. amerik. Engl. v. Nikolaus Stingl u. Dirk van Gunsteren. Rowohlt, 400 S., geb., 26 €.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.