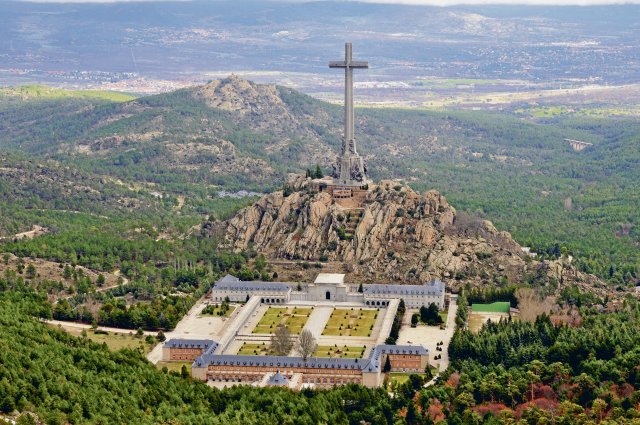- Politik
- Ukraine und Russland
Sprachpolitik: »Ethnonationalisten spalten die Ukraine«
Die Anthropologin Anastasia Piliavsky über die Sprachpolitik in der Ukraine und die Stellung des Russischen

Seit 2014, spätestens seit dem russischen Einmarsch 2022 wurde die Sprachfrage in der Ukraine zu einem großen Politikum. Zuletzt forderte die Ombudsfrau für Sprachen, Olena Iwanowska, Russisch aus der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen zu streichen. In der Ukraine aber hört man nach wie vor viel Russisch in Bussen, auf der Straße und Geschäften. Also ist die Sprache noch präsent.
Klar, Russisch wird nach wie vor im öffentlichen Raum in der Ukraine verwendet. Besonders häufig wird Russisch an der Front, in den Schützengräben gesprochen. Ich hatte kürzlich mit einem Bekannten telefoniert, der an der Front kämpft. Und während des Gespräches hörte ich, wie im Hintergrund seine Kollegen sprachen: Sie haben alle Russisch gesprochen. Mein Freund arbeitet seit drei Jahren an einem Film über eine Brigade der Dritten Sturmeinheit (Die Einheit wurde vom Rechtsradikalen Andrij Bilezkij gegründet, der sie bis heute leitet. Die ersten Mitglieder kamen vom faschistischen Asow-Regiment, dessen Symbolik die Einheit bis heute verwendet, Anm. d. Red.). Dort sprechen sie alle miteinander Russisch.
Wenn der Sprachkonflikt im Alltag nicht so scharf ist, wie oft dargestellt, was ist dann das Problem?
Das Problem ist, dass wir hier in der Ukraine eine ethnonationalistische Minderheit haben, die das Narrativ verbreitet, die ukrainische Sprache sei das entscheidende identitätsstiftende Element des Landes. Diesen Ethnonationalisten ist unsere Zweisprachigkeit ein Dorn im Auge. Ja, fast alle Bewohner der Ukraine sind zweisprachig. Es gibt Ukrainer, die sich in der ukrainischen Sprache wohler fühlen, es gibt Ukrainer, die sich in der russischen Sprache wohler fühlen, und es gibt Ukrainer, die sich in beiden Sprachen gleichermaßen wohlfühlen.

Die Odessitin Anastasia Piliavsky ist Professorin für Anthropologie am King’s College London. Sie ist Gründerin von Cosmopolis, einem Zusammenschluss von Intellektuellen, die sich dem Schutz kultureller Freiheiten verschrieben haben und entschlossen gegen Kulturkriege eintreten. Sie ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen zur Ukraine und zu Indien in »Spectator«, »Economist« und der »Times of India«.
Sind diese Ethnonationalisten wirklich nur eine kleine Minderheit?
Für die Mehrheit der Ukrainer war ihre Identität nie mit der ukrainischen Sprache verknüpft. Als sich die Ukrainer 1991 in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für die ukrainische Unabhängigkeit ausgesprochen hatten, war die Zustimmung überall überwältigend, auch in Gebieten mit russischsprachiger Bevölkerung. Bei den Präsidentschaftswahlen 2019 gab es einen Kandidaten (Petro Poroschenko, Anm. d. Red.), der die Wichtigkeit der ukrainischen Sprache als identitätsstiftendes Merkmal betonte, und einen anderen Kandidaten, Wolodymyr Selenskyj, der ein liberales politisches Programm hatte, sich für kulturelle und sprachliche Freiheiten einsetzte. Seinen Wahlkampf hat Selenskyj auf Russisch geführt und die Wahlen mit 73 Prozent gewonnen. Sein Gegner gewann nur in einem Gebiet. Es zeigte sich: Wer auf die nationalistische Karte setzt, verliert einen Wahlkampf. Bisher hatten bei allen Präsidentschaftswahlen, mit Ausnahme der Wahl von Viktor Janukowitsch, die Kandidaten gewonnen, die ein politisches und kein nationalistisches Programm hatten.
Wird die russische Sprache in der Ukraine diskriminiert?
In der Ukraine gibt es in den Schulen keinen Unterricht mehr in russischer Sprache. Nicht einmal als Fremdsprache wird Russisch unterrichtet. Auch ukrainische Schriftsteller, die Russisch geschrieben haben, wie beispielsweise Isaac Babel, werden nicht mehr in den Schulen behandelt. Wer im Gesundheitswesen, in einem Geschäft, einem Café oder einem Restaurant arbeitet, muss nun ausschließlich Ukrainisch sprechen. Russischsprachige Lieder, auch ukrainische, dürfen auf der Straße nicht gesungen werden.
Und was bedeutet das für die Gesellschaft?
Die meisten Opfer dieses Krieges sind russischsprachige Ukrainer. Russland greift vor allem Gebiete an, in denen die Menschen vorwiegend Russisch sprechen. An der Front kämpfen viele, vielleicht ist es sogar die Mehrheit, die russischsprachig ist. Es sind also vor allem die russisch sprechenden Ukrainer, die Opfer von Putins Aggression sind. Und nun werden sie auch innerhalb der Ukraine diskriminiert. Ich weiß von Flüchtlingen aus dem Donbass, denen bei ihrer Durchreise nach Westeuropa in Lwiw gesagt wurde: »Ihr seid schuld an diesem Krieg, weil ihr Russisch sprecht.«
Aber warum sollte die Ukraine Russisch, die Sprache des Landes, das die Ukraine überfallen hat, schützen?
Die russische Sprache, deren Wurzeln in der Kiewer Rus liegen, gehört Russland nicht. Die Kiewer Rus war ein mittelalterliches ostslawisches Reich, das vom Ende des 9. bis zum 13. Jahrhundert bestand. Es gilt als gemeinsames historisches Erbe der heutigen Staaten Ukraine, Russland und Belarus. Russisch wird auch in Kasachstan, der Republik Moldau, der Mongolei und anderen Ländern und Regionen gesprochen. Wir in Odessa sprechen unsere eigene Variante des Russischen, und für viele Odessiter ist es, insbesondere nach fast vier Jahren Bombardierungen, eine Beleidigung, mit Russland identifiziert zu werden. Das entfremdet die Odessiten von der Ukraine.
Was sind die Folgen dieses Umgangs mit der russischen Sprache in der Ukraine?
Wir Ukrainer unterscheiden uns von Russland nicht durch die Sprache, sondern dadurch, dass wir eine andere politische Vision, eine andere politische Kultur haben. Wir wollen demokratische Rechte, Freiheiten, wollen nicht in einem Staat leben, der von Verboten und Zwängen geprägt ist. Sprachverbote machen die Ukraine zu einem Russland, also zu einem Staat, der die Menschen zwingt, so oder so zu sprechen. Mit ihrer Gleichsetzung von der Ukraine und der ukrainischen Sprache wiederholen die Ethnonationalisten das Narrativ der russischen Propagandisten, von Lawrow und Putin, die unermüdlich wiederholen, dass alle russisch sprechenden Russen seien. So steht es auch in der russischen Verfassung. Das Vorgehen der Ethnonationalisten spaltet unsere Gesellschaft, unsere Nation. Ihr Narrativ spielt dem Kreml in die Hände und ist antipatriotisch.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Wie weiter?
Es gibt kein Land in Europa, das Sprachgruppen, die mindestens zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen, keine Rechte gewährt. In der Ukraine sprechen weit mehr als zehn Prozent überwiegend Russisch. Die Sprachfrage hat ein enormes Sprengpotenzial. Bei einer weiteren Unterdrückung der russischen Sprache kann es zu Konflikten kommen, möglicherweise sogar zu Unruhen, die einem Bürgerkrieg ähneln.
Wahrscheinlich funktioniert es nicht, zwei Sprachen gleichzeitig zu schützen.
Es handelt sich hierbei nicht um ein Nullsummenspiel, bei dem eine Sprache auf Kosten der anderen gewinnt. In der Ukraine sprechen fast alle hervorragend Ukrainisch, einschließlich derjenigen, die es vorziehen, Russisch zu sprechen. Sie ist ein zweisprachiges Land. In Kasachstan ist die Situation ähnlich: Die aktive Entwicklung des Kasachischen hat die Verwendung des Russischen nicht eingeschränkt, und die weit verbreitete Verwendung des Russischen behindert nicht die Entwicklung des Kasachischen. In Indien wird heute mehr Englisch gesprochen als zu Kolonialzeiten, in Algerien mehr Französisch.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.