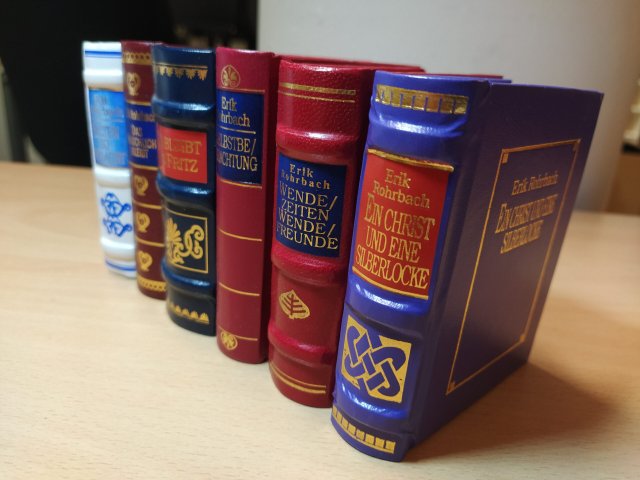- Berlin
- Wissenschaft
Berliner Hochschulen: Unsicherheit als konstante Größe
Vier von fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern haben einen befristeten Arbeitsvertrag

Der Wissenschaftsbetrieb an den Berliner Hochschulen und Universitäten ist weiterhin kein Ort, an dem man sich für die Zukunft einrichten kann. Der Berliner Senat erklärt sich zwar bemüht, doch die Befristungsquote von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen geht nur leicht zurück und bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Über alle öffentlichen Hochschulen und Universitäten hinweg lag sie 2024 bei 84 Prozent. Im Jahr 2019 waren noch 86 Prozent aller wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen befristet angestellt. Die Zahlen gab die Wissenschaftsverwaltung auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Tobias Schulze bekannt.
An den Universitäten ist der Anteil von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit befristeten Verträgen besonders hoch. An der Technischen Universität (TU) und der Humboldt-Universität (HU) liegt die Befristungsquote trotz eines leichten Rückgangs um zwei Prozent seit 2019 immer noch bei 92 Prozent (TU) beziehungsweise bei 80 Prozent (HU). An der Freien Universität liegt sie bei 86 Prozent (Rückgang um drei Prozent). An den weniger forschungsintensiven Hochschulen, etwa an der Weißensee Kunsthochschule Berlin oder der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch fällt die Quote 2024 mit 49 beziehungsweise 43 Prozent deutlich niedriger aus.
In den Hochschulverträgen mit dem Land Berlin sind Zielquoten verabredet, die die Bildungseinrichtungen zu mehr entfristeten Verträgen bewegen sollen. Doch wie die Zahlen der Wissenschaftsverwaltung andeuten, ist der Effekt dieser Vereinbarungen äußerst gering. Eigentlich sahen die ab 2018 geltenden Verträge beim wissenschaftlichen Personal eine Entfristungsquote von 35 Prozent vor, die bis zum Ende des Jahres 2020 erreicht werden sollte, beziehungsweise eine Steigerung der Quote um mindestens fünf Prozent für Einrichtungen mit Ausgangswerten unterhalb von 30 Prozent. Keine der Berliner Universitäten konnte diese Werte erreichen.
Obwohl die Universitäten die vereinbarten Vorgaben verfehlten, wurden sie mit den aktuell laufenden Verträgen nochmal erhöht. Nun sollen die Universitäten bis Ende 2027 eine Entfristungsquote von 40 Prozent erreichen, die Hochschulen von 35 Prozent.
Besser fällt die Quote aus, wenn man die drittmittelfinanzierten Stellen herausrechnet, also Gelder, die etwa für Forschungszwecke vom Bund bereitgestellt werden. Hier kommt die TU Berlin auf 82 Prozent (2019: 86 Prozent), die FU auf 73 Prozent (2019: 76 Prozent) und die HU auf 62 Prozent (2019: 64 Prozent).
»Wir haben ein Heer von befristeten Post-Docs ohne Perspektive auf eine Professur oder eine unbefristete Stelle. Viele akademisch Ausgebildete gehen deshalb ins Ausland.«
Tobias Schulze Hochschulpolitischer Sprecher im Abgeordnetenhaus (Linke)
»Auch mit dem Wissen, dass die Befristung des wissenschaftlichen Personals nur langsam erfolgen kann, sehen wir leider nur sehr wenig Bewegung«, sagt Tobias Schulze, hochschulpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus zu »nd«. Dafür gäbe es auch kaum einen Anreiz. Im Gegenteil: »Gerade jetzt, wo den Hochschulen Gelder gestrichen werden, sind auslaufende Verträge leider ein zentrales Mittel, um Personalkosten zu sparen.« Die laufenden Hochschulverträge, um deren Änderung angesichts der Haushaltseinsparungen gerungen wird, sehen keine Sanktionen vor für den Fall, dass die Hochschulen die Befristungsquoten nicht erfüllen, sagt Schulze. »Wir haben ein Heer von befristeten Post-Docs ohne Perspektive auf eine Professur oder eine unbefristete Stelle«, sagt Schulze weiter. »Viele akademisch Ausgebildete gehen deshalb ins Ausland.«
Um dem Problem der grassierenden Kettenbefristung in der Forschung zu begegnen, hatte die damalige rot-rot-grüne Landesregierung 2021 das Landeshochschulgesetz geändert. Nur noch unter eingeschränkten Voraussetzungen sollten Befristungen für Mitarbeiter*innen mit Doktortitel zulässig sein. Damit habe das Land Berlin seine Gesetzgebungskompetenz überschritten, urteilte im zurückliegenden Juli das Bundesverfassungsgericht.
»Unser Gesetz hätte die Möglichkeit der Befristung nach einer Promotion stark eingeschränkt«, sagt der Linke-Politiker Schulze heute. »Dann hätten sich die Hochschulen überlegen müssen, was sie mit ihrem Personal dauerhaft anfangen wollen, statt es nur für begrenzte Zeit den Professuren beizuordnen.« Wäre das Gesetz nicht gekippt worden, wäre eine grundsätzliche Reform unabdingbar gewesen, glaubt Schulze. Er spricht von der »Etablierung von eigenständigen wissenschaftlichen Tätigkeiten unterhalb der Professuren«. Der Ball hierfür liege jetzt beim Bund. Er hoffe zudem auf entsprechende Debatten in den Hochschulen selbst.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.