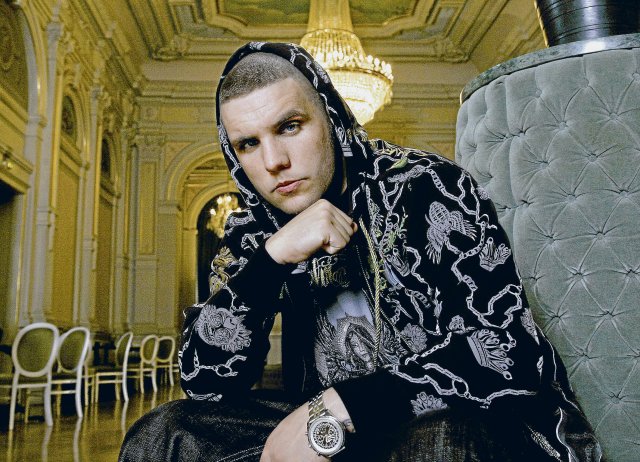- Kultur
- Literaturgeschichte
Anna Seghers: »Mein liebes einziges Leben!«
Die Briefe der jungen Anna Seghers an ihren Geliebten und späteren Ehemann László Radványi

Zwei junge Menschen desselben Jahrgangs 1900 verlieben sich ineinander an dem Tag, an dem sie sich erstmals begegnen, und bleiben für ein Leben zusammen. Über diese frühe Zeit der Gemeinsamkeit von Anna Seghers und László Radványi wusste man bisher wenig. Dann plötzlich tauchen rund 470 Briefe auf: der sprichwörtlich überraschende »Fund auf dem Dachboden«. Der Enkel Jean Radvanyi entdeckte im Nachlass seines Vaters, des Seghers-Sohnes Pierre Radványi, den unscheinbaren Karton, der eine wahre Sensation barg.
Netty Reiling, die später den Künstlernamen Anna Seghers wählt, schrieb sie zwischen März 1921 und August 1925 an László Radványi, der wie sie an der Universität Heidelberg studierte. Anhand dieser Briefe können wir die Entwicklung der Schriftstellerin von einer behüteten Tochter aus bürgerlich-jüdischer Familie in Mainz zu einer selbstbestimmten jungen Frau mitverfolgen. Sie erschienen nun, rechtzeitig zum 125. Geburtstag der Schriftstellerin. Dank László Radványi, der sie glücklicherweise sorgsam zu kleinen Päckchen gebündelt, in den Umschlägen belassen und in Zeitungsseiten der Epoche verpackt hat, sodass man sie nach dem Poststempel genau datieren kann. Seine Antwortbriefe sind leider nicht vorhanden.
Ganz anrührend sind die fantasievollen, vielfältigen Anreden, ein ganz besonderes Liebesvokabular voller Zärtlichkeit. Da heißt es etwa: »mein Brüderchen«, »Vater«, »Tschibok«, »liebes gutes Rodihündchen«, »mein Hirschhorn«, »mein Wildpferd«, »lieber Zarthäuptling«; sie bezeichnet sich selbst als »Deine Schwester«, »Dein Kind«, als Tochter und Geliebte. Tschibi (ungarisch für kleines Küken) und Rodi, diese beiden Kosenamen bleiben dann lebenslang an ihnen hängen. Es ist eine Liebe gegen Widerstände, denn obgleich auch Radványi aus guter jüdischer Familie in Budapest stammt und sehr gebildet ist, lehnt Nettys Vater, ein wohlhabender Mainzer Antiquitätenhändler, diese Verbindung aufgrund der kommunistischen Gesinnung des jungen Mannes zunächst vehement ab. Zunehmend leidet Netty Reiling unter der Einengung ihrer Individualität in den traditionellen Familienstrukturen. »Wenn Du bei mir bist, sehe ich Wirklichkeit […]. Mein Schmerz ist bei Dir geborgen«, schreibt sie ihm. Dann fühlt sie, dass sie mit ihm zusammen alles bestehen kann – aber nur dann. Es ist ein schmerzhafter Prozess, sich aus dem Elternhaus zu lösen. Aber als Studentin der Kunstgeschichte, Geschichte und Sinologie emanzipiert sie sich allmählich. 1924 promoviert sie in Heidelberg mit der Doktorarbeit »Jude und Judentum im Werke Rembrandts« und besteht auf ihrer Liebe zu Rodi: »Liebe Seele, behalte mich in Dir, denn sonst bin ich heimatlos und frier«.
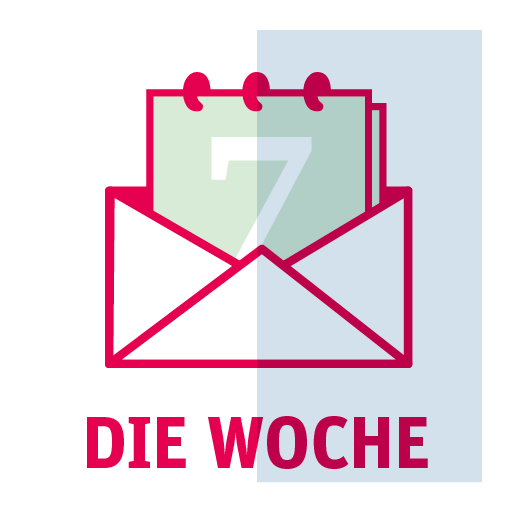
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Ihre Suche nach dem eigenen Platz im Leben findet in den schwierigen politischen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg statt: Inflation, Arbeitslosigkeit, französische und englische Besetzung des Rheinlandes. Aber auch den zunehmenden Antisemitismus in der Gesellschaft registriert sie als Bedrohung. Für einen jungen Ausländer, zudem mit kommunistischen Verbindungen, ist es fast aussichtslos, eine Stelle zu finden – die Bedingung, die Nettys Vater stellt. Er promoviert bereits 1923 an der Universität Heidelberg (mit summa cum laude), gilt als ein hochbegabter philosophischer Kopf, doch eine materielle Lebensgrundlage zu erlangen fällt ihm schwer. Hier zeigt sich, dass Netty die weitaus Praktischere von beiden ist: Sie gibt ihm Ratschläge, an wen er sich wenden, wie er sich kleiden, was er essen soll, wie er sich ihren Eltern gegenüber verhalten möge. Sie sorgt sich um alle lebenspraktischen Belange und ist es schließlich selbst, die die erste gemeinsame Wohnung für das junge Ehepaar findet. Auch die politischen Zuspitzungen in der jungen Weimarer Republik registriert sie sehr genau. Sie hat Angst um Rodi – wie auch später immer wieder in ihrem Leben – und bittet ihn, sich nicht in Gefahr zu bringen, indem er sich in kommunistischen Kontexten exponiert. Auf eine Stelle für ihren Liebsten hofft sie voller Inbrunst, jedoch: »Die einzige Bitte an Dich ist, in den nächsten Jahren nicht Rußland, ich weiß jetzt auch genau warum.« Radványi findet schließlich eine Tätigkeit bei der sowjetischen Handelsvertretung in Berlin.
Netty Reiling beginnt bereits in dieser Zeit, sich literarisch zu äußern. Zahlreiche Entwürfe und erste Veröffentlichungen von Geschichten in Zeitungen und Zeitschriften bestätigen sie in ihrem Weg. Immer stärker zeigt sich ihre Begabung, ihr unbändiger Wille zu schreiben. Zugleich trägt ihre umfangreiche Lektüre zum Befreiungsschlag bei: Dostojewski, Kierkegaard, Strindberg u.v.a. Die Radikalität ihres Lebensentwurfs deutet sich bereits hier an. Diese Briefe sind ein wahrer Glücksfall, denn solche unvermuteten Funde beleuchten die Zusammenhänge zu ihrem frühen Werk beträchtlich. Bei der Publikation ihrer fantastischen Erzählung »Die Toten von der Insel Djal« in der Weihnachtsnummer der »Frankfurter Zeitung« 1924 fällt dann erstmals der Autorenname Seghers. Als ihr die Eltern im November eine Reise nach Paris schenken, beginnt sie die Erzählung »Die Legende von der Reue des Bischofs Jehan d’Aigremont von St. Anne in Rouen« zu schreiben und führt ein einziges Mal im Leben ein Tagebuch. Dadurch wissen wir vom Stellenwert des Schreibens auf ihrem Weg der Selbstvergewisserung.
Ein starkes, durchgängiges Motiv der Briefe ist das Verhältnis zur Religion, zur jüdischen wie auch zur christlichen. Ihre Religiosität ist damals noch ganz virulent. »Möge Gott mir helfen«, »weil Gott mich Dir gegeben hat«, diese Formulierungen sind nichts Äußerliches, sondern tief in ihr verwurzelt – was sich später auch immer wieder in ihrer Literatur zeigt. Die Heirat mit László am 10. August 1925 erfolgt ganz nach jüdischem Brauch in ihrem Elternhaus in Mainz. Doch dann macht sie sich unmittelbar frei von den familiären Fesseln und geht mit ihrem Mann nach Berlin – der Stadt, in der sie endgültig zur Schriftstellerin werden kann.
Der Bildteil des Bandes bietet zusätzlich einen intimen Einblick in das Gefühlsleben der jungen Schriftstellerin: zum Teil reizende kleine Zeichnungen in Nettys Briefen, zum anderen oft unbekannte Fotos. Das einfühlsame Nachwort ihres Pariser Enkelsohns Jean Radvanyi (Jg. 1949) führt mitten hinein in die Zwanzigerjahre der Metropole Berlin.
Anna Seghers: »Ich will Wirklichkeit.« Liebesbriefe an Rodi 1921–1925. Hg. von Jean Radvanyi und Christiane Zehl Romero. Aufbau, 463 S., geb., zahlr. Abb., 28 €.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.