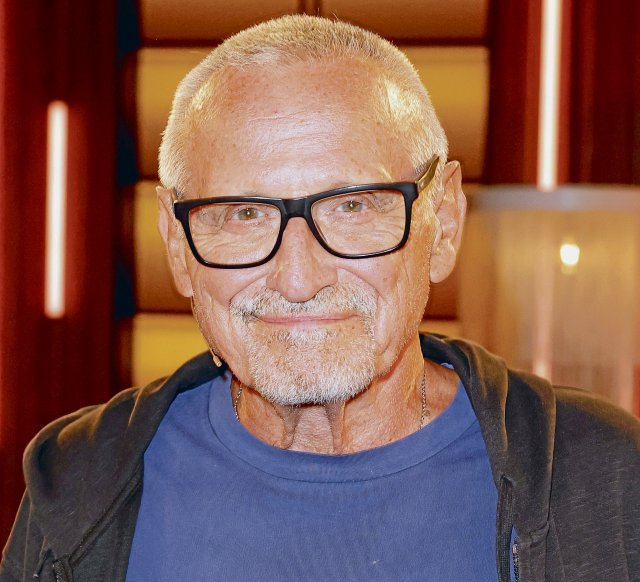- Kultur
- Geschichte des Sozialismus
Augen links, Orientierung nach Osten!
Die »Gesellschaft der Freunde des neuen Russland« (1923–33) war deutsche Aufbauhelferin und Propagandaorganisation für die junge Sowjetunion.

Was verband Albert Einstein, Erfolgsautoren wie Thomas und Heinrich Mann, Alfred Döblin und Franz Werfel, Johannes R. Becher, Anna Seghers sowie die Verleger Samuel Fischer und Ernst Rowohlt mit der Frauenrechtlerin Helene Stöcker, dem Funkpionier Graf Arco, bildenden Künstler wie Otto Dix, Max Pechstein und Otto Nagel, auch modernen Architekten von Walter Gropius, Hans Poelzig und Erich Mendelsohn bis zu Mies van der Rohe und Ernst May – abgesehen von ihrer deutschen Herkunft und prominenten Stellung in Wissenschaft und Kultur der Weimarer Republik? Sie alle waren Mitglieder der »Gesellschaft der Freunde des neuen Russland«, gegründet 1923 in Berlin.
In den zehn Jahren ihres Bestehens bis zur nationalsozialistischen Terrorherrschaft förderte die Gesellschaft den künstlerischen und wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Dies geschah durch Informationsveranstaltungen, organisierte Reisen, Begegnungen und Ausstellungen. Ihre Zeitschrift »Das Neue Russland«, erschienen 1924 bis 1932, und die erhaltene Korrespondenz der »Freunde des neuen Russland« mit Moskau dokumentieren eine sehr erfolgreiche Initiative zur Versöhnung und Kooperation der beiden Länder nach der militärischen Auseinandersetzung im Ersten Weltkrieg.
Das kulturpolitische Engagement folgte auf die diplomatische Anerkennung des ersten sozialistischen Staates durch die junge deutsche Republik, besiegelt mit dem Vertrag von Rapallo im April 1922. Rückendeckung kam vom Auswärtigen Amt und für die Finanzierung sorgten zunächst Willi Münzenberg und dessen »Internationaler Arbeiterhilfe« (IAH), später vor allem die sowjetische Regierung.
Eine Nichtregierungsorganisation linksliberaler Kreise der Berliner und deutschen Nachkriegsgesellschaft, staatlich geduldet und von fremden Mächten bezahlt durch einen Aktivisten der von Moskau gesteuerten Kommunistischen Internationale (Komintern) beziehungsweise vom Kreml: War der Kulturverein, dem Einstein, die Mann-Brüder, Mies van der Rohe und viele andere angehörten, in Wirklichkeit ein »ausländischer Agent«?
Zu diesem wichtigen Kapitel eigener und deutsch-russischer Kulturgeschichte fehlt leider bis heute eine solide Monografie. Die Zeitschrift der Gesellschaft sowie deren unveröffentlichte Korrespondenz mit der sowjetischen Partnerorganisation WOKS sind in Berlin zugänglich. Die 1925 gegründete »Allunionsgesellschaft für kulturelle Verbindung mit dem Auslande« (Vsesojuznoe obščestvo kultur´noj svjazi s zagranitsej, Abk. VOKS/ WOKS) koordinierte im Volkskommissariat des Äußeren die weltweit nach deutschem Vorbild gegründeten Freundschaftsgesellschaften. Moskauer Versuchen, sie als abhängig Angestellte zu führen, begegneten die Köpfe der Freundschaftsgesellschaft in ihrem Eigensinn jedoch mit bewundernswertem Geschick.
Bescheidene Mittel, großes Programm
Der Traum von einer deutschen Revolution war längst nicht ausgeträumt, als Aktivisten und Sympathisanten im Beisein russischer Gäste im Frühsommer 1923 das Projekt auf die Beine stellen. Rhein und Ruhr waren französisch besetzt, Deutschland litt unter Hyperinflation; dem Land stand ein heißer Herbst mit revolutionären Aufständen bevor. Gegründet wurde der »Bund der Freunde des neuen Russland« durch eine parteiübergreifende Allianz progressiver Kräfte aus Wissenschaft, Kunst und Politik, die keine Diktatur des Proletariats und bolschewistische Terrorherrschaft anstrebten, sondern ein deutsches Wirtschaftswunder mit sowjetischer Hilfe. Viele interessierte das »große Experiment«: der künstlerische Aufbruch im früheren Russischen Reich und das gigantische Modernisierungsprojekt der sowjetischen Regierung.
Am 27. Juni 1923 versammelte sich das erweiterte Organisationskomitee, neben Reichstagspräsident Paul Löbe (SPD) insgesamt etwa 100 Personen. Ein Mitglied des Arbeitsausschusses, der Kulturhistoriker Eduard Fuchs, erklärte einem zeitgenössischen Bericht zufolge, die Republik könne »nicht ohne Russland gesunden«. Die neue Gesellschaft verfolge das Ziel, so Fuchs, »weite Kreise Deutschlands über Russland nach allen Richtungen hin zu informieren«, um auf dieser Basis eine gemeinsame Kulturarbeit zu beginnen.
Moskauer Regierungsvertreter waren anwesend, ein Stellvertreter des für Bildung und Kultur zuständigen Volkskommissars Lunatscharski, der Künstler David Sterenberg, Mitorganisator der Ersten Russischen Kunstausstellung in Berlin 1922 und Abgesandte der Akademie der Wissenschaften, ebenso Trotzkis Schwester Olga Bronstein, verheiratete Kamenewa. Die Spitzenfunktionärin koordinierte für die sowjetische Regierung internationale Kulturkontakte, bevor sie als Gründungsdirektorin von WOKS die deutsche Initiative viele Jahre weiter materiell über Wasser hielt, aber auch intellektuell förderte.
Auf Erfolgskurs brachte die »Gesellschaft der Freunde« deren Generalsekretär Erich Baron. Er übernahm Anfang 1924 das Berliner Büro und war Herausgeber aller neun Jahrgänge der Zeitschrift »Das neue Russland«, die seit Juni 1924 erscheint. Die Fäden im Hintergrund zog Eduard Fuchs. Der Publizist und Sammler war im deutschen Bürgertum sowie unter Intellektuellen und Künstlern ein bekannter Mann. Sein subversiv-aufklärerischer Ansatz, politische Karikaturen in die Arbeiterpresse zu bringen, hatte der Sozialdemokratie Sympathien in breiten Gesellschaftskreisen verschafft. Der Autor einer illustrierten Kultur- und Sittengeschichte (»Sittenfuchs«) hatte aus Protest gegen deren Zustimmung für Kriegskredite 1914 die SPD verlassen und war dem pazifistischen »Bund Neues Vaterland« beigetreten. Dem gehörte seine politische Ziehmutter Clara Zetkin an und mit Arco, Einstein, Holitscher und Stöcker schon der aktive Kern des späteren »Bundes der Freunde des neuen Russland«.

Mit Lenin war er persönlich bekannt. Anfang 1919 reiste Eduard Fuchs als Mitglied des Spartakusbundes im Auftrag von Rosa Luxemburg nach Moskau, um mit dem Führer der Bolschewiki und Staatsgründer zu besprechen, wie die deutsche Revolution nach eigenem Plan, doch mit Geld aus Moskau gelingen könnte. Weder Saalredner noch Parteisoldat, dafür intellektueller Netzwerker, wirkte er fortan als »Mann im Schatten« für die gemeinsame Sache. Fuchs war jetzt in der Kommunistischen Partei Deutschlands, ebenso wie Erich Baron. In seiner Zehlendorfer Villa verkehrten sowjetische Politiker und Künstler, Lunatscharski und Trotzki ebenso wie der Regisseur des »Panzerkreuzer Potemkin« Sergej Eisenstein.
Wer bestimmt nun, wo es langging? Als Moskau Erich Baron vorwarf, den gewünschten Wissenschaftleraustausch und die neue Zeitschrift noch nicht auf den Weg gebracht zu haben, platzte Fuchs der Kragen. »Sie beurteilen die Sachlage total falsch«, schrieb er am 15. April 1924 an Kamenewa, »wenn Sie glauben, die deutschen Gelehrten fallen in solchen Mengen Russland begeistert um den Hals. … Es genügt nicht, zu dekretieren«. Er verteidigte Baron, der oft ohne warmes Mittagessen professionelle Arbeit leistete, und verteidigte die eigene Linie: »Von Ihrer Einsicht in die harte Realität der Dinge wird es abhängen, ob unsere Resultate sich in Zukunft erheblich steigern lassen oder nicht.«
Soviel Frechheit gegenüber dem Geldgeber mag erstaunen. Jedoch leisteten diese »Freunde« der Sowjetmacht auch wertvolle Dienste. 1923 besichtigte Vorstand Max Osborn, Kunstkritiker der »Vossischen Zeitung«, die früheren Zarenschlösser und verstaatlichte Privatsammlungen. Zurück in Berlin verteidigte er die Sowjetmacht gegen Vorwürfe der Kulturbarbarei und hob deren Verdienste um Bewahrung, Erforschung und breitenwirksame Vermittlung der nationalen Kunstschätze hervor. So geschehen auf der ersten öffentlichen Veranstaltung der Gesellschaft im Preußischen Herrenhaus am 26. November 1923 vor etwa 700 Zuhörern.
Dort referierte im Dezember 1923 Graf Arco über »Technisch-wissenschaftliche Arbeit im neuen Russland«. Der Erfinder der drahtlosen Telegraphie, stellvertretender Chef des Telefunken-Konzerns, hatte im Auftrag Lenins 1922 den Sender Moskau eingerichtet. Unter Arcos Leitung profilierte sich die technische Sektion der Freundschaftsgesellschaft zum Ansprechpartner sowjetischer Spitzenforscher und Dienststellen, die am wissenschaftlich-technischen Fortschritt der Deutschen zu partizipieren suchten.
Zu dieser Sektion zählten auch die Architekten. Aktivstes Mitglied seiner Berufsgruppe war Bruno Taut, ein Pionier des Neuen Bauens. Er plädierte für industrielle Methoden im Wohnungsbau und setzte auf eine »straffere Zusammenfassung der Staatsleitung«. Als die erhoffte Resonanz im eigenen Land ausblieb, suchte er über Baron und Kamenewa den Kontakt zu Moskauer Experten. Im Oktober 1924 besichtigte der Chef des Wohnungsamts im Moskauer Sowjet mit ihm die neuesten Großwohnanlagen in Berlin. Mitte 1926 fuhren Taut und Mendelsohn zu Gesprächen über Arbeitersiedlungen in die Sowjetunion; Erich Mendelsohn erhielt den Großauftrag für eine Textilfabrik in Leningrad.
Die öffentlichkeitswirksame Arbeit zeigte Früchte. Die Zahl der Anmeldungen wuchs; am Ende zählte die Gesellschaft rund 1800 Mitglieder. Baron übermittelte viele Anfragen und Hilfsgesuche nach Moskau, wie den Wunsch einiger linker, junger Bauhäusler in Weimar, die bereits 1925 in die Sowjetunion auswandern wollten.
Schauprozesse und Städtebau
Über die Aktivitäten der Gesellschaft und zugehörige Ereignisse und Themen berichtete deren Zeitschrift in Wort und Bild. Anfänglich ein Informationsblatt, erschien »Das neue Russland« alle zwei Monate und seit 1927 im roten Umschlag mit Schriftgestaltung und Fotomontage von John Heartfield.
Zu den großen Erfolgen ihres Bemühens gehört das Gastspiel des Moskauer Meyerhold-Theaters in Berlin im Frühjahr 1926. Parallel arrangierten Baron und WOKS eine Reise des Deutschen Theaters von Max Reinhardt in die sowjetische Hauptstadt. Der Austausch der beiden Ensembles zählt wohl zu den herausragenden Ereignissen deutsch-russischer Kulturbegegnungen im 20. Jahrhundert. Am Empfang für den Regisseur Wsewolod Meyerhold und dessen Frau, die Schauspielerin Sinaida Reich, nahm der berühmte Jugendstilkünstler Heinrich Vogeler teil, nunmehr Kommunist und Dokumentarist des sowjetischen Aufbaus. Auch er gehörte zur Freundesgesellschaft. Eine Fotografie in deren Zeitschrift zeigt ihn mit Gattin Sofia, Tochter von Julian Marchlewski, des verstorbenen Gründers der Komintern-Organisation »Rote Hilfe«.
Olga Kamenewa reiste im Mai 1927 nach Berlin, sprach bei den »Freunden« über »Frau und Kind in der Sowjetunion« und präsidierte beim Empfang der Gesellschaft für den Dichter Majakowski. Außerdem galt es, die Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution in Moskau vorzubereiten. Unter Gästen aus aller Welt, die im November 1927 in der sowjetischen Hauptstadt weilten, stellten die Deutschen mit über 100 Teilnehmern die größte Delegation. Für Eduard Fuchs war dies der zweite Besuch im real existierenden Sozialismus, für die Künstlerin Käthe Kollwitz eine Premiere. Zur Reisegruppe zählten prominente Mitglieder der Gesellschaft sowie der rote Medienzar Willi Münzenberg und der Chef der deutschen Lufthansa. Nach dem Fest lud Frau Kamenewa Vertreter ausländischer Freundschaftsgesellschaften in ihre Dienststelle, untergebracht in der prächtigen Villa eines enteigneten Automagnaten. Dort wetterte Fuchs gegen sowjetische Finanzhilfen, die seine Gesellschaft dem Vorwurf aussetzten, ein Agent Moskaus zu sein. Einmal mehr plädierte er für Eigenständigkeit; WOKS leiste moralische und kulturelle Hilfe – und damit genug.
Alles Bemühen der Berliner wurde von innenpolitischen Entwicklungen in Moskau konterkariert. Nach Abreise der internationalen Gäste erfolgte Ende 1927 der Parteiausschluß von Trotzki und Kamenev. Aus Protest verließ Reichstagspräsident Löbe die Gesellschaft. Die Ausrichtung ihres Freundschaftsdienstes änderte sich nun und geriet zum Balanceakt.
Das sowjetische Verlangen, in Deutschland immer weitere Kreise für Solidaritätsbekundungen zu gewinnen, drohte die auf Intellektuelle, Künstler und Wissenschaftler ausgerichtete Tätigkeit der Gesellschaft zu unterwandern. Als in Moskau 1928 mit dem Schachty-Prozeß und dem Prozeß gegen die Industriepartei 1930 Sündenböcke für negative Begleiterscheinungen der forcierten Industrialisierung des Landes präsentiert und verurteilt wurden, sogar drei deutsche Spezialisten, organisierte die Gesellschaft Sympathiebekundungen und mobilisierte bekannte Namen für öffentliche Auftritte. In Reaktion auf eine vielbeachtete Protesterklärung, die Albert Einstein unterzeichnet hatte, und nach Austritten namhafter »Freunde« wie Hans Poelzig und Heinrich Mann, veranstaltete Baron im Herbst 1930 eine Gegenkundgebung. Hier verteidigte Holitscher die Todesurteile; Anna Seghers und Ludwig Renn, der rasende Reporter Egon Erwin Kisch und andere rechtfertigten die Sowjetjustiz. Es wurden Telegramme von Romain Rolland, Martin Anderson Nexö und Käthe Kollwitz verlesen, die das »schändliche Werk der Intervention« verurteilte.
Nicht immer und überall stand Politik im Vordergrund. So schrieb der Leiter der Münchner Ortsgruppe, der das dortige Intourist-Reisebüros leitete, Ende 1931 an WOKS: »Vielleicht schicken Sie mir einmal ein paar Eisbären oder ausgestopfte Paläoarktiker für das Schaufenster, einen tanzenden Schamanen oder eine schöne Turkmenin. Ethnographische Objekte interessieren immer.«
Der Traum von einer deutschen Revolution war längst nicht ausgeträumt.
Ein literaturgeschichtliches Ereignis, das kaum bekannt ist, war der Vortrag des Majakowski-Freundes Ossip Brik am 25. März 1930 in Berlin, drei Wochen vor dem Selbstmord des Dichters. Der Moskauer Literaturwissenschaftler sprach in geschliffenem Deutsch über »Die neueste Literatur im sozialistischen Aufbau der Sowjetunion«. Die Veranstaltung fand im Hotel »Russischer Hof« am Bahnhof Friedrichstraße statt, wo die Gesellschaft ihr Auskunftsbüro hatte und viele Vorträge, Konzerte und Empfänge der Gesellschaft stattfanden. (Erich Baron arbeitete in der Wohnung seiner Familie in Berlin-Pankow.) Unter den Zuhörern: Bertolt Brecht und Walther Benjamin, Malik-Verleger Herzfelde, Holitscher und auch Baumeister Bruno Taut. Wie ein WOKS-Vertreter nach Moskau meldete, widersprach der Schriftsteller Béla Illés dem Referenten vehement. Der ungarische Kommunist gehörte zur sowjetischen Organisation proletarischer Schriftsteller RAPP. Eine Kostprobe vom Richtungskampf in der sowjetischen Kulturpolitik seit der 1928 erfolgten Ablösung von Anatoli Lunatscharski.
Sehr engagiert widmete sich das »Das Neue Russland« seit 1930 der deutschen Beteiligung am Bau neuer Städte in der Sowjetunion. Erich Baron gewann den Frankfurter Stadtbaudirektor Ernst May, der mit seinem Stab in die SU ging, als die Weltwirtschaftskrise das Baugeschehen in Deutschland zu Stillstand brachte, als Mitglied. Ende 1930 traf er May in Moskau, berichtete auch über dessen vielbeachteten Auftritt im Preußischen Herrenhaus. Geplant war ein eigener Band über sowjetischen Städtebau mit Beiträgen von May, B. Taut, Gropius und Martin Wagner sowie Nikolai Miljutin, Volkskommissar für Finanzen und Städtebau-Visionär im Rowohlt-Verlag, der jedoch nicht zustande kam.
Ende der Kooperation
Olga Kamenewa wurde im Sommer 1929 abgelöst. Ein WOKS-Geheimbericht aus Berlin von Ende 1928 richtete sich auch gegen ihre deutschen Partner. Da wurde verlangt, Baron abzusetzen und den Vorstand auszutauschen; Wunschkandidaten waren der Malik-Verleger sowie Felix Weil, der das Frankfurter Institut für Sozialforschung finanzierte. Kein Wunder, hatte Vorstandsvorsitzender Eduard Fuchs doch gerade die Partei verlassen und sich der KPD (O) der vormaligen Parteivorsitzenden Thalheimer und Brandler angeschlossen, die den von Stalin diktierten Kurs der KPD unter Thälmann kritisierten.
Erich Baron und die Gründerväter und -mütter der Gesellschaft hielten dem Druck der sowjetischen Freunde stand. Die Schreiben von WOKS wirken jetzt technokratisch, es geht um Jahrespläne, Kennziffern, um Verbreitung von Beiträgen und Agenturfotos, die niemand bestellt hat. Baron wurde zum Rapport nach Moskau zitiert und verteidigte dort die eigene Linie. Sein letzter Auftritt ist wörtlich überliefert, der Bericht datiert vom 21. September 1932. Darin heißt es: »Die politische Lage erfordert selbstverständlich gerade jetzt erhöhte taktische Umsicht und Elastizität.« Deswegen sollten eigene Veranstaltungen außer durch »aufklärenden und belehrenden Charakter« durch hohes intellektuelles Niveau überzeugen, »um ihren Zweck zu erfüllen, die Sympathien der uns politisch noch fernstehenden Kreise zu gewinnen und über die kulturelle Ebene hinaus ein Band der Freundschaft und der gemeinsamen Interessen zu knüpfen«.
Ein halbes Jahr darauf kam Erich Baron in einem Berliner Gefängnis zu Tode. Olga Kamenewa wurde 1941 in sowjetischer Haft erschossen. Eduard Fuchs ging nach dem Reichstagsbrand ins Exil. Er starb 1940 in Paris.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.