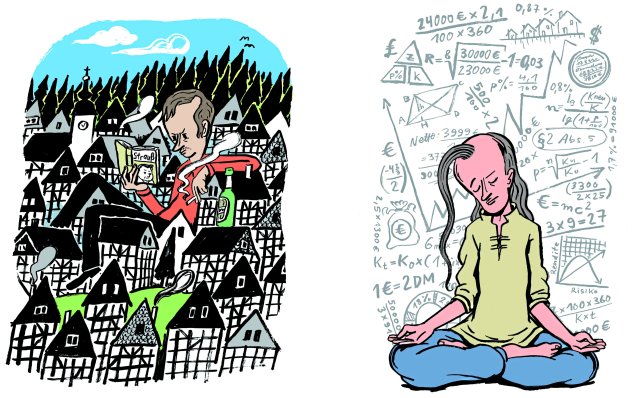- Kultur
- »A Dog Called Money«
Hätte sie doch einfach nur gesungen
Unangenehm und überambitioniert: Der Dokumentarfilm »A Dog Called Money« der Musikerin PJ Harvey
Durch Krisengebiete reisen, um sich von ehemaligen Kriegsschauplätzen und von Armut geprägten Stadtteilen für seine Kunst »inspirieren« lassen, begleitet von einem preisgekrönten Filmemacher, die gewonnen Eindrücke in ein neues Musikalbum fließen lassen, beim Aufnehmen dieser Platte in einem schicken aquariumartigen Studio von bourgeoisen Besucher*innen bestaunt werden, später dann einen Dokumentarfilm auf den Markt werfen, nebenbei auf das Elend der Welt aufmerksam machen: Falls Sie denken, dass sich all das ziemlich nervig anhört - dann liegen Sie richtig.
PJ Harvey ist vor einigen Jahren für ihre Platte »The Hope Six Demolition Project«, die 2016 erschienen ist, durch Afghanistan, den Kosovo und Washington D. C. gereist, gemeinsame Sache machend mit dem Filmemacher Seamus Murphy, der schon bei dem vorausgegangenen Gedichtband »The Hollow of the Hand« mitwirkte. 2019, im letzten coronafreien Jahr unserer Zeitrechnung, lief »A Dog Called Money« in den Kinos an - und sorgte für durchwachsene Kritik. Ihre Inspirationsreisen wurden unter anderem als »Elendstourismus« und »Armutssafari« bezeichnet - mit Fug und Recht. Und wenn es schon 2019 unangenehm gewesen sein muss, diese Doku zu schauen, dann ist es 2021 natürlich nicht besser. Die Geflüchtetenkrise in Moria ist immer noch akut, »Black Lives Matter« erlebte im letzten Sommer unfassbar große Aufmerksamkeit, die Pandemie hat die Welt immer noch im Griff. Genau jetzt die PJ-Harvey-Doku zu schauen, ist wie eine Reise in ein längst vergangenes Zeitalter.
Harvey spaziert in einer merkwürdigen Mischung aus schüchtern und prätentiös in unglamourösen, aber teuren Outdoor-Klamotten durch die verschiedenen Länder, und Murphy hält die Kamera drauf. Dabei herausgekommen sind - vielleicht auch versehentlich - merkwürdige Szenarien, gefilmt in einer unangenehmen »National Geographic«-Ästhetik, in der Menschen als irgendwie interessante, aber namenlose Deko- und Inspirationsobjekte vorkommen. Noch befremdlicher wird das Ganze durch die lyrischen Segmente, die Harvey aus dem Off über die Bilder drüberquatscht. Dass Pop-Musik-Lyrik nicht immer große Dichtkunst bedeuten muss und dass weiße, privilegierte Menschen vielleicht eh ein sonderbares Verständnis von Kunst haben, offenbart sich an so schrägen Versen wie »the rich are poor and the poor are rich«, also die Reichen seien arm und die Armen reich - auch das bedeutungsschwangere Vortragen macht es nicht besser.
Und so geht es weiter, in einem ständigen Betonen von Dualismen der »armen« und der »reichen« Welt. »Arm und reich«, »Krieg und Frieden«, »Kunst und Müll« - drunter macht es Harvey nicht. Wenn am Ende dabei Ominöses wie »Sein Gesicht war wie eine Karte, die ich studieren musste« und »Leute lassen sich von Dollarnoten an die Kette legen« herauskommt, dann fragt man sich nicht nur, ob man die Doku direkt abschalten sollte - man fragt sich auch, wie man jemals wieder ein PJ-Harvey-Album hören kann, ohne an ein mittelschlechtes Literaturseminar zu denken.
Die Aufnahmen aus dem voll verglasten aquariumartigen Studio im Somerset House in London, in dem Harvey nach ihren Reisen vor Publikum ihr Album aufnahm, machen es dann auch nicht besser - obschon diese Sequenzen teils von der Filmkritik gelobt wurden. Da wird ein bisschen geplänkelt, auf dem Flipchart rumgemalt, PJ Harvey möchte, dass alles aufgeräumt und clean ist - es sind avantgardistische Kunstproduktionsprozesse, die gezeigt werden, und zwar in all ihrer Langatmig- und auch Spießigkeit. Man könnte diese Szenen einfach so wegzischen - wären da nicht all diese unangenehmen Lyrics, die es ins »The Hope Six Demolition Project« geschafft haben. Im besten Fall kitschig (»Community of Hope«), im schlimmsten Fall problematisch (zum Beispiel, wenn Harvey über die Schwarzen Bewohner*innen eines Stadtteils von Washington D. C. als »Zombies« singt) - der Öargs-Momente sind absolut viele, wenn man sich die Platte nach dem Konsum von »A Dog Called Money« anhört.
Das Lehrstück am Ende ist: Natürlich können privilegierte Künstler*innen einen an ihren kreativen Schaffensprozessen teilhaben lassen - aber letztlich sollte man es als Fan und Rezipient*in am besten einfach nicht so genau wissen wollen.
»A Dog Called Money«: Irland/Großbritannien 2019. Regie: Seamus Murphy. Mit: PJ Harvey. 94 Min. (Salzgeber)
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.