- Politik
- Kriegsdienstverweigerung
Komplizierte Dienstverweigerung
Einsteiger und Aussteiger aus der Bundeswehr finden bei Friedensorganisationen Unterstützung

»Die Zivilgesellschaft hatte in den vergangenen Jahren weniger mit Kriegsdienstverweigerern zu tun, als das noch in den 1980er, 90er und 2000er Jahren der Fall war«, sagt Michael Schulze von Glaßer von der Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK). Seine Organisation stellt sich derzeit auf eine neue Welle von Kriegsdienstverweigernden ein, denn die Zahlen steigen schon jetzt.
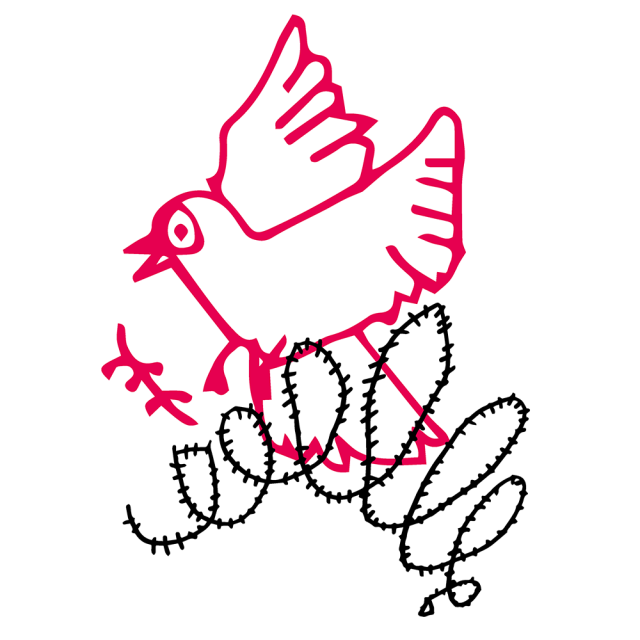
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine stellt die Linke vor neue Fragen. Die Linkspartei und die gesellschaftliche Linke überhaupt. Nato, EU, Uno, Russland, Waffenlieferungen, Sanktionen – dies sind einige Stichworte eines Nachdenkens über bisherige Gewissheiten und neue Herausforderungen. Wir beginnen eine Debatte über »Linke, Krieg und Frieden«, die uns lange Zeit begleiten wird.
»Die Struktur, um Verweigerer zu beraten, ist leider weg«, sagt Detlef Mielke von der DFG-VK Regionalgruppe Hamburg. Mielke, der 1977 selbst als Wehrpflichtiger und Reservist tätig war, nimmt für seine Ortsgruppe an einer Sitzung teil, in der es um den Umgang mit künftigen Kriegsdienstverweigernden - kurz KDVler*innen - geht.
Galt es zu Zeiten der Wehrpflicht hauptsächlich, Schulabgänger, oft Abiturienten, zu unterstützen, sind es heute drei Gruppen von Menschen, die Anträge auf Kriegsdienstverweigerung stellen: Aktive Soldat*innen, Reservist*innen und Ungediente. Allen voran entscheiden sich aktive Soldat*innen für den Ausstieg aus dem Militärdienst.
»Eine Verweigerung ist für die Soldat*innen mit existenziellen Problemen verbunden«, sagt Wolfgang Buff, der lange Zeit im Vorstand der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung tätig war. Er kennt die Entwicklung der Verweigerungsprozedur, die zunächst einem Tribunal glich, vor dem junge Männer ihre schriftlich dargelegten Beweggründe vertreten und teils perfide Befragungen überstehen mussten. Je mehr die Armee schrumpfte und die Einberufungszahlen sanken, desto mehr wurde Verweigern zum Aufsatzwettbewerb und letztlich zu einem Durchwinken der Anträge.
»Die Verwaltungsgerichte haben keine Kapazitäten, mit den Anträgen umzugehen«, schildert Buff aus der Praxis. Es dauere mitunter ein Dreivierteljahr, teilweise gar anderthalb Jahre, bis über Verweigerungsanträge aktiver Soldat*innen gerichtlich entschieden sei. »Für die Betroffenen ist das eine immense Belastung, vor allem, wenn sie weiter auf der Dienststelle erscheinen müssen und schikaniert werden«, so Buff, der jetzt in der Stiftung Friedensbildung aktiv ist. Auch im familiären Bereich fehle es mitunter an Unterstützung, wenn die Entscheidung der KDVler*innen nicht nachvollzogen oder gestützt wird. Für Reservist*innen, die einen KDV-Antrag stellen, sind die Folgen weniger harsch, da ihnen meist nur weitere Wehrübungen erspart bleiben.
»Es fehlt vor allem an Rechtsanwälten, die sich bei der Kriegsdienstverweigerung wirklich auskennen«, so Buff. Der Aufwand für eine Verweigerung stehe in keinem Verhältnis mehr, das sich für Kanzleien rechne und zu einer Spezialisierung tauge. Quasi alle Kanzleien, die über eine Expertise auf dem Gebiet verfügten, seien mittlerweile altersbedingt geschlossen.
Die Zahlen der Kriegsdienstverweigerungen sind nach dem Aussetzen der Wehrpflicht zunächst kontinuierlich gesunken. Das zuständige Bundesministerium für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben teilte auf nd-Anfrage mit, dass im Jahr 2012 noch 473 KDV-Anträge eingingen. Ihre Zahl sank dann bis 2019 auf 110 Anträge ab. Seit 2020 ist der Anstieg aber deutlich. Von 137 Anträgen stieg die Zahl dann im Jahr 2021 auf 201 Anträge. Für 2022 sind bis einschließlich 23. März bereits 179 Verweigerungen eingegangen.
Lesen Sie auch die Kolumne »Vom Pflichtdienst zum Politikum«
von Daniel Lücking
Unklare Beweggründe
Hinter den steigenden Zahlen von Kriegsdienstverweigernden vermutet Michael Schulze von Glaßer nicht nur den Ukraine-Krieg als Auslöser. »Während der Corona-Pandemie haben auch Soldat*innen viel Zeit im Homeoffice verbracht und waren nicht so sehr den Dynamiken in der Truppe ausgesetzt wie im regulären Dienst. Vielleicht hat das den einen oder anderen Denkprozess angestoßen«, so Schulze von Glaßer.
Die Bundeswehr selbst reagiert auf KDV-Anträge mitunter auch mit Dienstzeitverkürzungen oder finanziellen Angeboten. Oft aber auch mit einer Musterung selbst. Insbesondere, wenn Menschen, die eigentlich nur verhindern wollen, jemals zum Wehrdienst herangezogen zu werden, einen KDV-Antrag stellen, steht ihnen zunächst ein Besuch in den Karrierecentern bevor, die über die Wehrtauglichkeit entscheiden, bevor die Anträge dann bearbeitet werden. Derzeit ist nicht abschätzbar, ob anerkannte Kriegsdienstverweigerer sich durch den Antrag bereits auf Listen für Wehrersatzdienst bringen.
Die Diskussion um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht hat aktuell noch wenig Fahrt aufgenommen. Im Verteidigungsministerium geht man von Kosten von bis zu einer Milliarde Euro aus, die eine Wiedereinführung verursachen könnte. Der Blick nach Schweden zeigt, wie ein neues Wehrpflichtmodell aussehen könnte. Dort wurde als Reaktion auf die russische Annexion der Krim, dem Krieg in der Ukraine und Militärübungen an der Grenze zum Baltikum die Wehrpflicht Mitte 2017 wieder eingeführt. 4000 Wehrpflichtige werden pro Geburtenjahrgang herangezogen. Ob das Interesse an der Wehrpflicht wieder aufkommt, ist unklar. »Wir sehen leichte Veränderungen der allgemeinen Bewerberlage und tatsächlich einen Trend nach oben, aber es ist zu früh, das schon zu bewerten«, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gegenüber »nd«.
Der Krieg in der Ukraine hat bei der DFG-VK auch ehemalige KDVler*innen reaktiviert, die ihre Erfahrungen jetzt in die Arbeit mit einbringen wollen. »Gleichzeitig hat die Bundeswehr immer neue Formate und Formen für die Rekrutierung entwickelt, auf die wir hinweisen und reagieren«, so von Schulze von Glaßer weiter. Mit sogenannten »Pop Up Stores« - also temporär eingerichteten Rekrutierungsläden, ähnlich dem am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin - zeigte sich die Bundeswehr bislang in sechs Einkaufszentren, zuletzt in Oberhausen. »Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. Niemand darf zum Kriegsdienst gezwungen werden, ganz unabhängig davon, wie der jeweilige Krieg politisch und völkerrechtlich zu bewerten ist«, sagt die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger, Sprecherin für Flucht- und Rechtspolitik der Linksfraktion.
»Wir werden auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass wir Kriegsdienstverweigernde unterstützen können, egal ob beim Weg raus aus der Truppe oder dabei, gar nicht erst dort zu landen«, so Schulze von Glaßer, der selbst noch mit wenig Aufwand ausgemustert wurde.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







