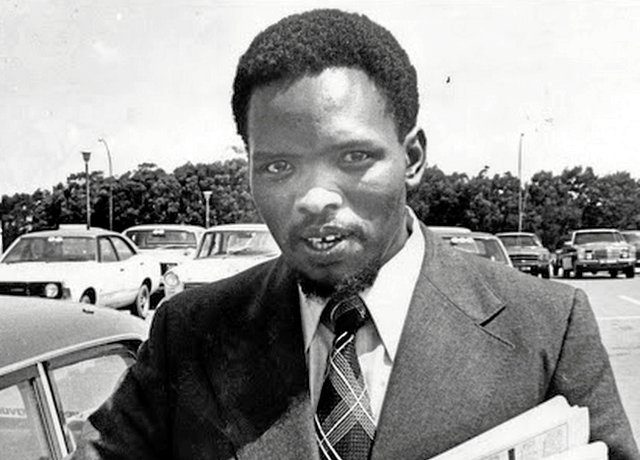- Politik
- G7-Finanzminister-Treffen
Mehr Inflation, höhere Zinsen, und dann?
Der Weltwirtschaft droht eine Abwärtsspirale. Die Zinswende könnte diese noch beschleunigen
Zwei Themen werden auf dem dreitägigen Treffen der Finanzminister und der Notenbankgouverneure der G7-Staaten, das an diesem Mittwoch in Königswinter bei Bonn beginnt, im Mittelpunkt stehen: der Ukraine-Krieg und die Zinswende. Auf die hohe Inflationsrate reagieren immer mehr Notenbanken klassisch und heben ihre Leitzinsen an.
Wichtigster Vorreiter ist einmal mehr die US-Notenbank Fed. Auf die Coronakrise hatte diese schnell mit einer drastischen Senkung des Leitzinses geantwortet. Auf die Inflation reagierte sie nun im März und Mai mit Trippelschritten nach oben. Inzwischen beträgt der Leitzins wieder 1,0 Prozent. So dürfte es Schritt für Schritt weiter gehen, denn mit 8,3 Prozent ist die US-Inflationsrate die höchste unter den G7-Staaten.
Auch Europa sollte sich nach Corona eigentlich mitten in einem robusten Aufschwung befinden. Doch Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat die Wachstumsprognose nun deutlich nach unten korrigiert, auf 2,7 Prozent. Anhaltende Probleme in den Lieferketten, steigende Energiepreise und nun auch noch Sanktionen belasten die Wirtschaft. Und seit Mitte 2021 steigt die Inflation. Die Europäische Zentralbank (EZB) steht wie andere Notenbanken damit vor einem Dilemma: Die schwächelnde Konjunktur verlangt nach niedrigen Zinsen, damit Kredite günstig bleiben und die Wirtschaft wachsen kann. Die Inflation verlangt nach einem deutlich höheren Leitzins, der die Preisentwicklung bremst. So sehen es die geldpolitischen »Falken«. Deren Gegner, die »Tauben«, meinen, man solle erst einschreiten, wenn sich Preise und Löhne über längeren Zeitraum gegenseitig hochschaukeln. Dergleichen sei aber nicht zu beobachten. Und schon für 2023 hofft die EU auf eine nur noch moderate Inflation.
Doch die Lage bleibt labil, zwischen den Währungsblöcken und auch innerhalb des Euroraums. Darauf weist der Europaexperte des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Martin Höpner, hin: »In der Eurozone gibt es nicht ›die‹ Lohnpolitik, sondern 19 unterschiedliche Lohnpolitiken – mit unterschiedlichen Institutionen der Lohnfindung, Kräfteverhältnissen, Problemwahrnehmungen und Reaktionsmustern auf ökonomische Schocks.« Ohne Gleichklang könnten sich im Euroraum unterschiedliche Inflationsraten verstetigen. »Genau so entstand die Eurokrise.«
Aussichten auf eine straffere Geldpolitik alarmieren derzeit die Vertreter aus hoch verschuldeten Ländern im EZB-Rat. »Sie fürchten offenbar, steigende Leitzinsen könnten die Renditen für Staatsanleihen in die Höhe treiben«, so Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Kramer. Wegen der hohen Schuldenstände vieler Länder sei eine neue Schuldenkrise dann nicht mehr auszuschließen.
Allerdings erscheinen die Zinsprobleme, die Westeuropa und Nordamerika bewegen, eher als Luxusprobleme, wenn man nach Argentinien schaut. Auch dort hat die vergleichsweise schwache Wirtschaft noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Vergangene Woche erhöhte die Banco Central ihren Leitzins auf 49 Prozent – aktuell Weltspitze. Auch die Türkei (Leitzins 14 Prozent), Kasachstan (14) oder Ghana (17) liegen weit oben.
Wie angesichts solch aufgeblähter Finanzmärkte die Realwirtschaft wieder Fahrt aufnehmen soll, bleibt rätselhaft. Zumal die Zinswende in den USA und wohl ab Juli in der Eurozone Dollar- und Euro-Kredite tendenziell verteuert. Länder mit einer schwachen Währung, wie eben Argentinien sowie viele weitere Schwellen- und Entwicklungsländer, sind aber auf »harte« Devisen angewiesen. Mittelbar wird also der Zinsanstieg in Washington und Frankfurt auch andere Länder belasten.
Dreimal so viele Länder wie noch vor der Corona-Pandemie sind in einer besonders kritischen Situation, warnt der »Schuldenreport 2022« von Erlassjahr.de. 39 Staaten seien »besonders akut« von Überschuldung bedroht oder wie Sri Lanka bereits betroffen. Für andere wird es teuer: Laut UN-Angaben sind die Kreditzinsen armer Staaten bereits achtmal höher als die von wohlhabenden Ländern. Dadurch schrumpfen die Mittel, die für die wegen der hohen Lebensmittelpreise derzeit besonders wichtige Armutsbekämpfung zur Verfügung stehen.
Ganz anders stellt sich die Zinsfrage für Rohstoffexporteure. Diese verdienen an der Inflation: Seit dem Beginn der Coronakrise haben sich die Weltmarktpreise für Energie- und Industrierohstoffe verdoppelt. Davon profitieren Länder wie Brasilien, Saudi-Arabien und möglicherweise Russland, die große Mengen Getreide, chemische Grundstoffe oder Erdöl exportieren.
Auf die Finanzkrise 2007/08 hatten fast alle Zentralbanken mit einer abgestimmten Senkung ihrer Leitzinsen reagiert. Es folgte ein Jahrzehnt des billigen Geldes. Damit ist spätestens seit diesem Jahr Schluss: Der Fachinformationsdienst »Leitzinsen« listet mehr als 50 Zentralbanken auf, die 2022 ihre Zinsen angehoben haben. Aus der Reihe tanzen zwei Schwergewichte: Chinas Zentralbank versucht, Pekings harten Lockdown-Kurs per Leitzinssenkung auf nun 3,70 Prozent abzufedern. Japan kämpft noch immer mit deflationären Tendenzen und hält an seinem Minuszins von 0,10 Prozent fest. Von geldpolitischer Koordinierung kann also keine Rede sein. Aber ohne diese drohen turbulente Zeiten.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.