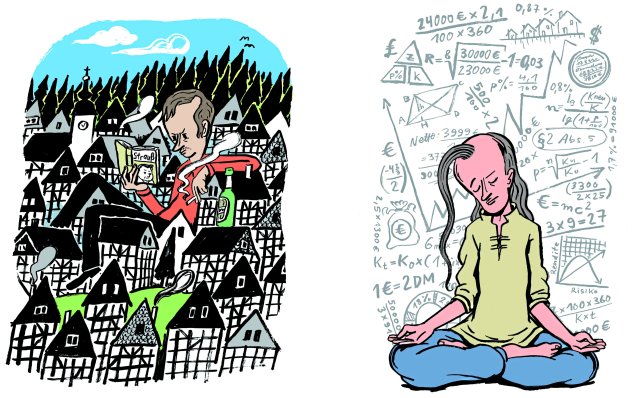- Kultur
- Unvergessene Einzelgänger
Einar Schleef: Ein Theaterkünstler, kein Menschenfreund
Heute wäre der Schriftsteller, Regisseur, Bühnenbildner und Maler Einar Schleef 80 Jahre alt geworden

In Deutschland, so hat es Elfriede Jelinek ausgedrückt, habe es nach dem Zweiten Weltkrieg nur zwei Genies gegeben. Im Westen sei das der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder gewesen; und im Osten – Einar Schleef. Genie, das ist ein reichlich überstrapazierter Begriff. Und wie sicher ist es schon, dass die Jelinek heute wieder dazu greifen würde? Viel zu stark haftet ihm der Geruch des vorletzten Jahrhunderts an; es ist ein Wort, das kein Femininum kennt. Der Superlativ Genie macht letztlich nur blind für die genialischen Details. Überhaupt: »Genie ist Interesse«, heißt es bei Brecht.
Aber mit welchem Wort kann man sich einem wie Einar Schleef nähern, ohne falsche Bilder hervorzurufen? Vielleicht so: In Deutschland hat es nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal einen großen Universalkünstler gegeben, und sein Name lautet Schleef. 1944 kam er in Sangerhausen auf die Welt.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Dem Theater hat er den Chor zurückgebracht. Als Regisseur sowie Bühnen- und Kostümbildner, als Dramatiker und Schauspieler hat er die Intendanten wie die Zuschauer in Ost, in West und im neudeutschen Ost-West-Konglomerat frappiert, mitunter um den Verstand gebracht. Kaum ein Theaterkünstler dürfte an derartig vielen nicht zustande gekommenen oder abgebrochenen Bühnenarbeiten beteiligt gewesen sein. Aber wenn Schleef Werke zur Premierenreife brachte, hatten sie eine solche Wirkung, dass bis heute, Jahrzehnte später, davon die Rede ist. Schleef-Anekdoten sind noch immer Futter in den Theaterkantinen. Nicht zu vergessen ist auch sein 1997 publizierter Monumentalessay »Droge Faust Parsifal«, Zeugnis eines radikalen Blicks auf die deutsche Kultur- und damit auch auf die Theatergeschichte.
Aber als Autor ließ sich Schleef nicht auf wenige Gattungen festlegen. Sein zweibändiges Opus magnum »Gertrud«, benannt nach seiner Mutter, kann man mit Recht als Jahrhundertroman bezeichnen. Erzählungen hat er ebenfalls verfasst. Wie jüngst bekannt wurde, hat er auch ein lyrisches Werk hinterlassen, das der Lektüre wert ist. Dazu kommen kaum überschaubare chronistische Schriften: einige Tausend Seiten Tagebuch, die nahezu ein halbes Jahrhundert dokumentieren, erschienen in fünf Bänden beim Suhrkamp-Verlag; und dann gibt es noch den umfassenden Briefwechsel zwischen Mutter und Sohn.
Ein Künstler, der auf und vor der Bühne wirkte, und ein viel schreibender Literat, der munter die Genres wechselt – das allein soll einen Universalkünstler machen? Einar Schleef, ausgebildet an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, war zunächst ein Bildkünstler. Als Maler und Grafiker hat er ein Werk geschaffen, das zu Unrecht im Schatten seiner Theaterarbeit steht. Und ganz wie nebenbei wirkte er auch als Illustrator, Fotograf, Hörspiel- und Filmemacher. Anders als viele Künstlerkollegen wurde er dabei nie zum Kopisten seiner selbst. Für jede Kunstform hat Schleef ein originäres, teils überraschendes Werk geschaffen.
Dass es jemanden, der sich künstlerisch nicht versteifen wollte, zum Theater zieht, leuchtet ein. Hier kommen alle Schwesternkünste, die Schleef interessierten, zusammen. Große Bilder schuf er auf der Bühne. Vor allem aber kämpfte er im wahrsten Sinne des Wortes für das literarische Theater. Sprache arbeitete er mit seinen Spielern durch. Der Maestro rühmte sich, den Darstellern erst das Sprechen beigebracht zu haben. Er selbst war Stotterer.
Dieser Schleef war kein Menschenfreund. Von quälenden Proben war und ist zum Teil die Rede. Aber die Pedanterie des Künstlers war nie Selbstzweck, sondern Zeugnis eines künstlerischen Selbstverständnisses. Kunst ist nicht Zufall, sondern Ergebnis genauen Arbeitens. Und wenn der freundliche Ton der direkten Anweisung Platz machen muss, geschieht das nicht aus Charakterschwäche, sondern ist Zeichen des gemeinsamen Glaubens an die Sache der Kunst. Dass die professionelle Kritik und das geneigte Publikum heute mitunter eher an guten Menschen als an guter Kunst interessiert sind, das hätte Schleef wohl kopfschüttelnd zurückgelassen.
Wie aber lernt man das Werk eines Universalkünstlers nach dessen Ableben kennen? Wo fängt man an, wo hört man auf? Nichts einfacher als das: Wo es zur Infektion gekommen ist, darf dem vom Virus Befallenen herzlich egal sein. Ist das Interesse erst geweckt, darf man die Spuren wie ein Schatzsucher zusammentragen. Für Aufzeichnungen der Theaterinszenierungen wird man als Nachgeborener in Archive steigen müssen; einzelne Szenenschnipsel daraus kann man in Dokumentationen finden – wie die nach Bruchteilen einer Sekunde Spannung erzeugenden Schnipsel aus »Ein Sportstück« am Burgtheater Wien.
In miserabler Qualität über Stunden aus dem Zuschauerraum abgefilmte Aufführungen, die einen doch nicht loslassen, finden sich im Netz. Billige Taschenbücher mit Schleefs Prosa bekommt man antiquarisch für Centbeträge; stark limitierte bibliophile Ausgaben einzelner Texte erfordern ein kleines Vermögen. Schleefs bildnerisches Werk wird kaum ausgestellt. Man wird es also suchen müssen!
Und wer nicht immun ist gegen das Schleef-Fieber, der sollte sich erzählen lassen von seinen Arbeiten. Wer ihm begegnet ist, weiß Geschichten zu erzählen. Kennen Sie die schon: Nach der Uraufführung von »Wessis in Weimar« in der Regie von Einar Schleef – wir schreiben das Jahr 1993 und befinden uns im Berliner Ensemble – rief die Brecht-Erbin Barbara Schall den Theatermacher an. Sie, die bei der Premiere nicht zugegen war, hatte gehört, dass die Inszenierung künstlerischer Qualität entbehre, weswegen sie für die kommenden Vorstellungen die Rezitation des Gedichtes »Wer aber ist die Partei?« ihres Vaters Bertolt Brecht verbiete. Schleef könne, fügte sie hinzu, das Gedicht ja abends unter seiner Bettdecke vorlesen. Schleef tat, wie ihm geheißen. Bei der nächsten Vorstellung kam er mit einer Bettdecke auf die Bühne, erzählte dem Publikum von seinem Telefonat und schaltete eine Taschenlampe an, um sodann mit Brecht zu fragen: »Wer aber ist die Partei?«
Heute wäre er, der 2001 in Berlin vor dem Alter Gestorbene, 80 Jahre geworden. Schleef bleibt in Erinnerung als radikaler Kunstarbeiter inmitten zahlreicher marktschreierischer Provokateure, deren kunstgewerbliche Erzeugnisse eher früher denn später in Vergessenheit geraten werden.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.