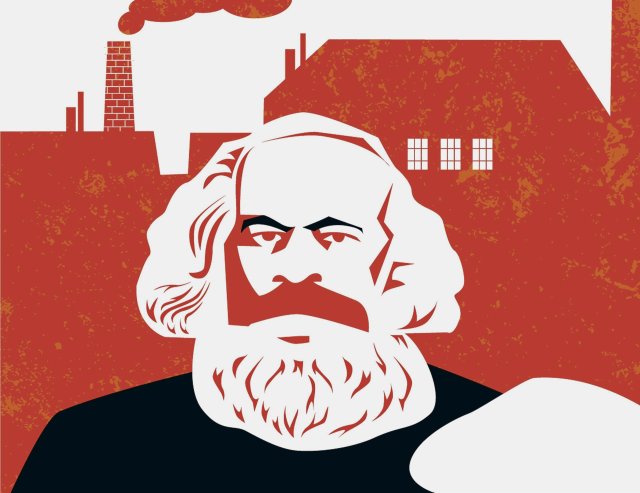- Kultur
- Charles Aznavour
»Monsieur Aznavour« im Kino: Zwischen Attitüde und Ausdrucksnot
Der französische Spielfilm »Monsieur Aznavour« ist eine Hommage an den Chansonnier Charles Aznavour

Einige Kapitel aus dem Leben des 1924 in Paris geborenen Shahnourh Vaghinag Aznavourian, der als Charles Aznavour zum Weltstar wurde. Das erste heißt »Zwei Gitarren« und gibt den kommenden gut zwei Stunden den Ton vor. Eine melancholische Spurensuche nach der verlorenen Zeit, nach den Quellen jener unerhörten Produktivität, die Aznavour als Sänger und Schauspieler ausgezeichnet hat. Musik, so wird hier deutlich, war dabei immer das Bindeglied zwischen gestern und heute, zwischen Leben, Liebe und Tod.
Die Eltern führten in Paris ein bescheidenes armenisches Restaurant. Oder genauer: immer mal wieder ein anderes, noch kleineres und einfacheres, wenn das vorherige pleitegegangen war. Was Armut ist, wusste der junge Charles Aznavour, der im Bohemeviertel Quartier Latin aufwuchs, sehr genau. Sein Wille, erfolgreich zu werden, war für ihn fortan immer mit der Vorstellung verbunden, einmal viel Geld zu verdienen. Als er später in New York Frank Sinatra trifft, sagt er diesem, sein Ziel sei, das gleiche (astronomisch hohe) Honorar für einen Auftritt zu bekommen wie dieser. Und das erreichte er tatsächlich. Aznavour besaß alle Vorzüge und Schwächen eines Menschen, der sich von ganz unten hochgearbeitet hatte.
2018 starb Aznavour, nachdem er zwei Wochen zuvor (im Alter von 94 Jahren) noch auf der Bühne gestanden hatte. Arbeit war sein Leben – und seine Passion. Einige Jahre zuvor hatte ich ihn in Berlin erlebt. Er war in hervorragender Verfassung, körperlich, geistig, stimmlich, aber strahlte dennoch eine ungeheure Distanz, fast schon Feindschaft dem Publikum gegenüber aus. Vor Beginn kam die Ansage, sollte es ein Blitzlicht aus dem Publikum geben, werde er das Konzert sofort abbrechen. Niemand zweifelte daran, dass er dies wirklich tun würde. Nein, Liebe zum Publikum heuchelte der alte Aznavour nicht mehr, er hatte zu viele Höhen und Tiefen erlebt, um jetzt noch jedem gefallen zu wollen. Mir imponierte die Art, wie er seine melancholischen Lieder sang (über 1000 schrieb und komponierte er), wie immer mit großem Orchester und Beteiligung von Familienmitgliedern – und doch nur wie für sich ganz allein.
Die launische Gunst des Publikums, um die er so viele Jahre gebuhlt hatte, interessierte ihn offenbar nicht mehr. Auch davon erzählt »Monsieur Aznavour« von Mehdi Idir und Grand Corps Malade, der auch von der Familie Aznavour mitproduziert wurde. Dies ist ein Spielfilm als Hommage, aber eine ansehenswerte, weil sie den Preis des Ruhms nicht unterschlägt.
Liebeslieder solle nur ein schöner Mann singen, und das sei er nicht, sagte man ihm in den 50er Jahren häufig mit unverblümter Direktheit.
Vor einigen Jahren kam eine ungewöhnliche Aznavour-Dokumentation heraus – lauter private Filmsequenzen, von ihm selbst mit seiner eigenen 8-Millimeter-Kamera im Laufe vieler Jahre aufgenommen. Aznavour wusste, dass Werbung schon der halbe Erfolg ist. Aber eben nur der halbe. Wehe, man versagt, wenn alle auf einen blicken! Die Familie war immer um ihn herum, seine Schwester stand ihm vermutlich näher als seine drei Ehefrauen. Und doch nahm sich Aznavours Sohn Patrick 1976 (mit 25 Jahren) das Leben – eine Wunde, die sich nie schloss, wie wir aus Selbstzeugnissen wissen.
Der Film wurde überaus aufwendig produziert, mit viel Sinn für das passende Ambiente. Aber funktioniert es, wenn man den unvergleichlich energiegeladenen Aznavour mit einem Schauspieler wie Tahar Rahim besetzt? Nur halb, denn Aznavour war nicht wie dieser sportiv-ausrechenbar, sondern auf unausrechenbare Weise schmächtig, mit einer eher geistigen als sinnlichen Ausstrahlung.
Liebeslieder solle nur ein schöner Mann singen, und das sei er nicht, sagte man ihm in den 50er Jahren häufig mit unverblümter Direktheit. Tatsächlich passte Aznavour nicht ins Klischeebild eines französischen Chansonniers. Er war nur 1,64 Meter groß und hatte eine immer etwas heisere Stimme, unschön, aber ausdrucksvoll. Also spielte er vor halb leeren Sälen vor einem Publikum, das ihn nicht mochte. Warum arbeitet er dann immer weiter, zwingt den Erfolg schließlich tatsächlich? Später wird Aznavour diese karge Zeit im Abseits in seinem Chanson »La Bohème« romantisieren. Sein Leben sei gerade in dieser Zeit ein »sehnsuchtsvoller Traum« gewesen: »Ich war der größte der großen Fantasten.«
Tahar Rahim, der Aznavour nicht selbst singt, beschränkt sich auf einige typische Gesten und Gesichtsausdrücke Aznavours. Dessen innere Glut aber vermag er nicht zu erzeugen, die Schärfe seines Geistes (der dem Sänger lange Zeit im Weg zu stehen schien) kommt hier gar nicht vor – so bekommt Tahar Rahims Aznavour etwas ganz und gar unpassend Eindimensionales, zuletzt Langweiliges.
Das passiert, wenn man zu einem Film keine eigene Idee hat, sondern nur etwas Vorgegebenes glaubt bebildern zu müssen. Doch die Persönlichkeit, die innere Spannung, auch Rücksichtslosigkeit dieses Mannes, überträgt sich so nicht. Stattdessen macht sich eine befremdliche Glätte breit. Gleiches passiert hier mit Édith Piaf, die bei Marie-Julie Baup von einer provozierend dreckigen Urgewalt zu einem possierlichen Abziehbild ohne Tiefe einschrumpft.
Ist das nun alles uninteressant, weil zu äußerlich dargestellt? Natürlich sagt ein Chanson von Charles Aznavour schon viel über ihn (zumal auch die Originalmusik im Film klug montiert wird). Immerhin, der historische Kontext trägt einiges dazu bei, dass man nach und nach doch in die Geschichte hineingezogen wird. Da wird von mehr erzählt als bloß von seinem Ehrgeiz, von Niederlagen und Ruhm.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Lebensgeschichte Aznavours beginnt in den 1920er Jahren in Paris und sie endet im Jahre 2018. Was für ein geschichtlicher Bogen! In den Nachtklubs der frühen 40er Jahre sitzen deutsche Besatzungsoffiziere; nicht nur einmal wird Aznavour auf der Straße verhaftet, weil man ihn verdächtigt, Jude zu sein. Natürlich hat ihn das geprägt, seinen Liedern einen ungewöhnlichen Ernst gegeben.
Im Dunstkreis von Édith Piaf beginnt er 1946 für sie Lieder zu schreiben – der Weg für ihn selbst auf die große Bühne ist da noch weit. Gewiss war es klug von ihm, sich parallel als Filmschauspieler (in über 70 Rollen!) zu etablieren. Seine Darstellung eines gescheiterten Konzertpianisten, der sich im kriminellen Milieu verstrickt, in François Truffauts »Schießen Sie auf den Pianisten« von 1960 schrieb Filmgeschichte. Ebenso seine Figur des jüdischen Spielzeugverkäufers in Schlöndorffs »Blechtrommel« oder sein jesuitisch-fanatischer Naphta in »Der Zauberberg«. Der Mensch Aznavour hatte so viel mehr Facetten, mehr Ecken und Kanten, mehr Getriebenheit als ihm dieses gewiss charmant daherkommende »Biopic« zubilligt.
Warum kommt einem Charles Aznavour, der vieles war (am Ende sogar armenischer Botschafter in der Schweiz) hier nicht wirklich nahe? Weil es das Regieduo Mehdi Idir und Grand Corps Malade nicht wagt, den Schritt vom äußeren Lebensbogen zu jenem »Weltinnenraum« zu gehen, der für Rilke die eigentliche Verbindung von Ich und Welt darstellt. Da ist zu viel Nachahmung und äußere Pose, aber zu wenig erforschte Ausdrucksnot im Spiel.
Was ließ ihn inmitten von Familie und Freunden zu einem manischen Sänger der hoffnungslosen Einsamkeit werden? Diese innere Biografie, der man erst eine Kontur hätte (er)finden müssen, wird hier nicht erzählt.
»Monsieur Aznavour«, Frankreich 2024. Regie und Buch: Mehdi Idir, Grand Corps Malade. Mit: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup. 134 Min. Kinostart: 22. Mai.
Wir sind käuflich.
Aber nur für unsere Leser*innen. Damit nd.bleibt.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Werden Sie Teil unserer solidarischen Finanzierung und helfen Sie mit, unabhängigen Journalismus möglich zu machen.