- Kultur
- Seltene Oper
Einsamkeit und Wirksamkeit mit Richard Strauss
Musikalisch eine Entdeckung: Christian Thielemann dirigiert Richard Strauss’ »Die schweigsame Frau« an der Staatsoper Berlin

Unter den Opern von Richard Strauss sind »Salome«, »Elektra« und »Der Rosenkavalier« die Repertoirestücke. Zuweilen begegnet man der »Frau ohne Schatten« und »Arabella«. Die zehn anderen sind auf der Bühne Raritäten. Dabei kann es sich durchaus lohnen, sie wieder einmal zu erproben; im vermeintlich trivialen Ehestück »Intermezzo« etwa zeigte letztes Jahr Tobias Kratzers Regie überraschende Spannungen.
Kurz nachdem Strauss begonnen hatte, »Die schweigsame Frau« zu komponieren, wurde den Nazis die Regierung übergeben. Die Bücher des Librettisten Stefan Zweig wurden als die eines Juden verbrannt – Strauss dagegen meinte, als Präsident der Reichsmusikkammer Gutes für die deutsche Kunst bewirken zu können. Immerhin setzte er, als 1935 die Dresdner Uraufführung anstand, durch, dass auch Zweigs Name genannt wurde. Nach wenigen Vorstellungen wurde die Oper abgesetzt und bis 1945 nur im Ausland inszeniert.
Doch auch später kam sie nicht oft auf die Bühne. Dabei bietet die Story dieser »komischen Oper«, für die Zweig auf ein Theaterstück des Shakespeare-Zeitgenossen Ben Jonson zurückgriff, durchaus wirksame Szenen. Sir Morosus, Admiral im Ruhestand, lebt isoliert und leidet unter jeglichem Lärm. Sein Neffe Henry hat sich gegen alle Standesregeln mit einer Theatertruppe zusammengetan und die Schauspielerin Aminta geheiratet. Morosus enterbt ihn.
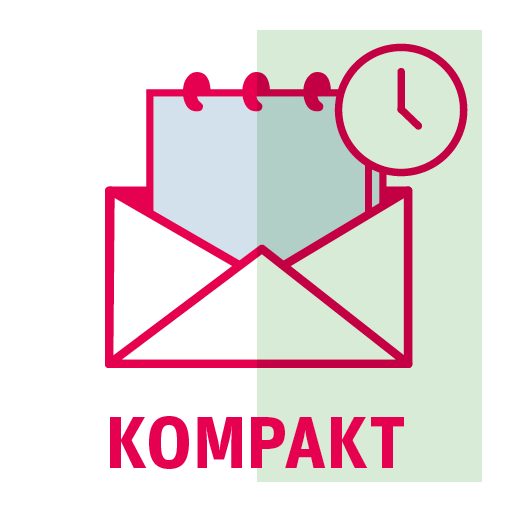
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Als Rettung vor der Einsamkeit bleibt ihm nur eine Heirat. Sein Barbier besorgt Ehekandidatinnen, ist dabei aber heimlich mit den Theaterleuten im Bund. Er arrangiert alles so, dass Morosus die scheinbar brav-unterwürfige – und vor allem stille – Timidia auswählt, die aber niemand anderes als Aminta ist. Sobald Morosus sich verheiratet wähnt, wandelt Timidia sich zur Furie, die den alten Mann hemmungslos traktiert – und vor allem: Lärm veranstaltet. Henry tritt nun als einzige Rettung vor der vermeintlichen Ehefrau auf.
Zweigs Libretto ist voller sprachlicher Feinheiten, und Strauss präsentiert eine seiner kompliziertesten Partituren. Schon in der Ouvertüre überlagern sich verschiedene Rhythmen, die Harmonik ist schwer zu fassen. Kurz: Die beiden haben ein solches Maß an Kunstanstrengung vorgelegt, dass die unmittelbare Wirksamkeit darunter leidet. Auch verzichten sie auf hämisches Verlachen. So sehr Morosus als Patriarch ein demütiges Weibchen sucht: Seine Einsamkeit wird so deutlich wie die Zuneigung, die er gegenüber Timidia entwickelt. Entsprechend zögert die Schauspielerin zunächst, plangemäß ihr Opfer zu traktieren.
Dies sind die vielleicht eindringlichsten Momente des Werkes. Gesteigert wird das dadurch, dass sie gegenüber ihrem wirklichen Ehemann Henry fremd tun muss und für einen Moment die Frage steht, ob die beiden sich wirklich fremd werden; die Komödie droht ins Ernste zu kippen. Das Ende ist freilich komödienhaft harmonisch: Das gegen Morosus veranstaltete Theaterspiel führt ihn zur Einsicht. Man kann sich fragen, ob es sich bei all dem um Eskapismus oder die Bewahrung von Humanität in schlimmen Zeiten handelt.
Regisseur Jan Philipp Gloger verlegt die Handlung ins Heute, in eine Berliner Altbauwohnung. Am Ende deutet er an, wie sich Wohnungsnot lösen ließe: Die Theatertruppe zieht bei Morosus ein, denn die Wohnung ist für einen Einzelnen zu groß. Projektionen informieren über das Problem Alterseinsamkeit, das ist gesellschaftlich wichtig. Nur kann man fragen, ob es das Problem von Morosus ist, dessen Lärmphobie nur äußerlich durch ein Kriegserlebnis erklärt ist und auf eine innere Hemmung hindeutet, die das Spiel im Spiel schließlich zu überwinden hilft.
Jenseits der überflüssigen Aktualisierungen lässt Gloger den Hauptpersonen erfreulich viel Raum. Peter Rose kann das Anrührende des alten Grantlers vermitteln, Siyabonga Maqungo überzeugt als sein Neffe. Brenda Rae als Aminta/Timidia lässt im ersten Akt mit etwas spitzer Stimme Befürchtungen aufkommen, gestaltet aber im weiteren Verkauf die tyrannische Ehefrau so überzeugend wie das Mitgefühl, das sie gegenüber Morosus entwickelt. Samuel Hasselhorn gibt dem Barbier, der das Spiel inszeniert, die angemessene Souveränität ohne Bosheit. Die Gruppenszenen allerdings scheitern am zu eng angelegten Bühnenbild und kommen oft nicht übers Gedränge und Gewusel hinaus.
Vor allem gehört der Abend dem Orchester. Die Partitur ist ideal für Christian Thielemann als Dirigenten und mit Vorliebe für den fein abgestuften, kulinarisch ausgehörten Klang. Entsprechend enthusiastisch feierten ihn seine zahlreichen Fans im Publikum der Staatsoper bei seiner ersten Premiere als Generalmusikdirektor (sie werden sich wieder gedulden müssen, für die Spielzeit 2025/26 ist keine weitere geplant).
Tatsächlich hielt Thielemann die Staatskapelle so weit zurück, dass den Sängern ihre sehr umfangreichen Partien erleichtert wurden, und lenkte doch die Aufmerksamkeit auf das Vielschichtige des orchestralen Geschehens. Das war ein entschiedenes Plädoyer für »Die schweigsame Frau« – freilich eines, das mehr unter musikalischem Aspekt überzeugte als unter dem der Bühnenwirksamkeit.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







