- Kommentare
- Antifaschismus
Volksfront – gegen wen oder was?
Alle beschwören die Einheit gegen rechts. Aber wer allein auf rechte Parteien starrt, wird den Faschismus nicht stoppen, meint Raul Zelik

Ende Juli haben die Labour-Abgeordnete Zarah Sultana und ihr ehemaliger Vorsitzender Jeremy Corbyn zur Gründung einer neuen Linkspartei in Großbritannien aufgerufen. Innerhalb von drei Wochen registrierten sich 600 000 Menschen für das Projekt. Ungefähr so viele, wie die drei größten britischen Parteien – Labour, Reform UK und Torys – zusammen an Mitgliedern zählen
Dabei ist klar, dass die neue Partei, die bislang unter dem Titel »Your Party« (»Deine Partei«) läuft, die Wahlen nicht gewinnen kann. Bei ersten Umfragen kam sie auf bis zu 18 Prozent – was ein enormer Erfolg wäre, aber nur für den vierten Platz reichen würde. Ganz vorne bei den Umfragen liegt mit knapp 30 Prozent die rechtsextreme »Reform UK«-Partei des Börsenmaklers Nigel Farage.
Nicht ganz falsch ist deshalb der Hinweis, dass Corbyns Projekt vor allem das Ende der Labour-Regierung besiegeln dürfte. Deren Chef Keir Starmer gewann 2024 zwar die Wahlen, aber fuhr damals ein katastrophales Ergebnis ein. Gerade einmal 9,7 Millionen Brit*innen wählten die Partei – unter dem Parteilinken Jeremy Corbyn waren es 2019 immerhin noch 10,3 Millionen gewesen.
»Einheit gegen rechts«?
Aus den Reihen von Labour wird Corbyn deshalb bereits vorgeworfen, er mache sich zum Steigbügelhalter der extremen Rechten. Statt die Regierung zu destabilisieren, sollten Linke auf einen Konsens mit bürgerlichen Kräften setzen, um die Faschisten von der Regierung fernzuhalten.

Raul Zelik ist Autor und nd-Kollektivist.
Ganz ähnlich wird oft auch in Deutschland argumentiert. Um Neuwahlen zu verhindern, segnete die Fraktion der Linken in Sachsen unlängst den Haushalt der weit rechts stehenden CDU-Landesregierung ab. Und auf Bundesebene mehren sich die Stimmen, die SPD und Grüne für ein Bündnis umwerben. So plädierte der Bundesgeschäftsführer der Linken Janis Ehling dafür, an einer Regierungsmehrheit links der CDU zu arbeiten. »Für Debatten, die dieses Ziel aus den Augen verlieren, habe ich in Zeiten, in denen eine faschistische Partei droht, stärkste Kraft zu werden, kein Verständnis.«
Die Linke in Großbritannien hat gar keine andere Wahl, als es gegen Labour zu versuchen.
Auf den ersten Blick scheint das alternativlos. Gegen die extreme Rechte muss man sich zusammenschließen und dafür eben auch Kompromisse eingehen. Bei Diskussionen über das Thema wird immer auch gern auf die KPD-Politik während der Weimarer Republik verwiesen. Die Komintern war 1924 zu dem Schluss gelangt, dass die sozialdemokratische deutsche Regierung gegen revolutionäre Aufstände kaum weniger repressiv vorgehe als die extreme Rechte und deshalb als »sozialfaschistisch« bekämpft werden müsse.
Bekanntermaßen erwies sich diese Strategie als fatale Fehleinschätzung und wurde ab 1933 korrigiert. Auf die »Sozialfaschismusthese« folgte die »Volksfront«-Politik, die breite Bündnisse unter Einschluss bürgerlicher Regierungen vorsah.
Faschismus geht auch ohne Faschisten
Weniger bekannt ist, dass auch die neue Strategie ausgesprochen problematisch war. Seit einiger Zeit wird im englischsprachigen Raum wieder häufiger darauf hingewiesen. Erwähnt wird vor allem die Kritik des in Trinidad geborenen schwarzen Revolutionärs George Padmore. Im Auftrag der Komintern hatte Padmore u.a. in Hamburg Arbeiter*innen organisiert und war 1933 von den Nazis verhaftet und später deportiert worden. Mit der neuen Volksfrontpolitik begann sich Padmore von der kommunistischen Partei zu distanzieren und wurde einige Zeit später ausgeschlossen.
Natürlich war auch der Gewerkschafter Padmore nicht dagegen, sich mit möglichst vielen Menschen gegen Faschisten zu organisieren. Was er an der neuen Linie für fatal hielt, war der Umstand, dass die kommunistischen Parteien auf eine Kritik am Kolonialismus verzichten sollten – um bürgerliche Regierungen nicht zu verstören. Die Verbrechen Großbritanniens, Frankreichs, Belgiens und der Niederlande wurden nicht mehr thematisiert, weil es ja galt, die Nazis zu stoppen.
Padmore, der wusste, »Wie Großbritannien in Afrika herrscht« (so der Titel eines seiner Bücher), hielt das für einen Verrat an linken Prinzipien. Und er verwies auf das Apartheid-Regime, das in Südafrika eine faschistische Rassenherrschaft errichtet hatte, ohne dass eine faschistische Partei dafür die Macht hätte ergreifen müssen. Rassentrennung, Genozid, Imperialismus, Siedlerkolonialismus – all das war zwar charakteristisch für das nationalsozialistische Projekt, aber zuvor auch schon von europäischen Kolonialmächten und Siedler*innen praktiziert worden.
Wer darauf verweist, will keineswegs behaupten, dass Kolonial- und Siedlermassaker dasselbe seien wie die Gaskammern in Deutschland. Vielmehr geht es darum zu zeigen, dass der Faschismus viel tiefer in den bürgerlichen Strukturen verankert ist als gemeinhin angenommen. Für den schwarzen Gewerkschafter Padmore war klar, dass es keine antifaschistischen Bündnisse geben darf, die elementare Anliegen von Unterdrückten zurückstellen. Gestoppt werden müssten nicht allein faschistische Parteien, sondern auch die zugrundeliegende Faschisierung.
Volksfront gegen wen oder gegen was?
In der deutschen Öffentlichkeit wird Faschismus normalerweise als eine Bewegung verstanden, die das bürgerliche System stürzen will. Viel plausibler aber ist, dass der Faschismus darauf abzielt, die bestehenden Verhältnisse zu vertiefen: Er will noch rassistischer, sozialdarwinistischer, antifeministischer und militaristischer sein.
Was aber sind dann die zentralen Inhalte seines Projekts? Ich würde behaupten, dass es dem Faschismus heute vor allem um folgende Anliegen geht: Er will erstens den Ausbau der Grenzen, die als Instrument verstanden werden, um Räume differenziert ausbeuten und die globalen Massen der Besitzlosen spalten zu können. Mit Grenzpolitik lässt sich festlegen, wer wie ausgebeutet werden kann und wer wo von Rechten ausgeschlossen bleibt.
Zweitens will der Faschismus die bestehende Geschlechterordnung vertiefen, die nicht zuletzt die (unentlohnte) Aneignung weiblicher Arbeit ermöglicht. Das erklärt auch, warum die extreme Rechte mit so großem Hass gegen trans Personen mobilisiert, denn letztere stellen die binäre Geschlechterordnung infrage.
Drittens geht es dem Faschismus darum, soziale Widersprüche durch die Anrufung der Nation zu verschleiern. Wer die »gemeinsamen« Interessen von oben und unten betont, muss über die Ungleichheit zwischen oben und unten nicht sprechen. Damit einher geht die Überhöhung der eigenen Ethnie oder Kultur, was eine Art »psychologischen Lohn« für einen Teil der Bevölkerung darstellt (wie es der Soziologe W.E.B. Du Bois ausgedrückt hat).
Viertens will der Faschismus dafür sorgen, dass die Interessen der Nationaleliten mit militärischen Mitteln gesichert werden können, und propagiert deshalb die militärische Aufrüstung. Und fünftens schließlich strebt er den Ausbau der Polizei- und Sicherheitsapparate bei einer gleichzeitigen Schwächung sozialer Sicherungssysteme an, was die Abolitionistin Ruth Wilson Gilmore als einen »anti-state statism« (antistaatlichen Staatsausbau) bezeichnet hat.
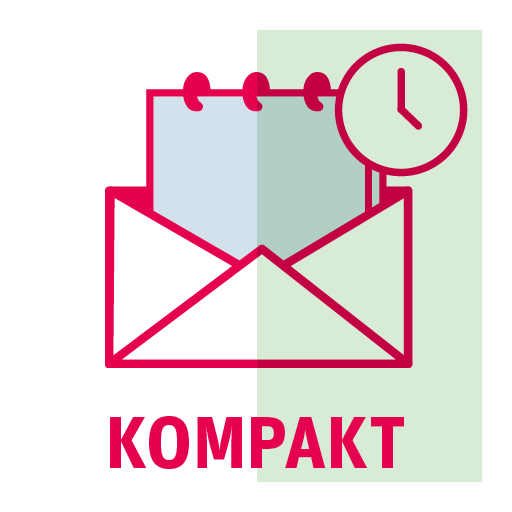
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Das ist zugegebenermaßen nur eine – funktionalistische – Erklärung von Faschismus. Darüber hinaus ist er zum Beispiel auch ein sozialpsychologischer Prozess, bei dem die eigene Identität bestärkt wird, indem man andere entmenschlicht.
Am Ende muss sich antifaschistische Politik daran messen, ob sie diesen Prozessen etwas entgegenzusetzen vermag. Bündnisse gegen die extreme Rechte reichen dafür sicher nicht. Wenn es dem Faschismus um die Vertiefung bestehender Machtverhältnisse geht, dann ist es vermutlich keine besonders schlaue Idee, gemeinsam mit bürgerlichen Verbündeten diese Verhältnisse zu stabilisieren.
In Großbritannien hat Labour in den vergangenen Jahrzehnten den gesellschaftlichen Rechtsruck aktiv mit vorangetrieben. Die Regierung von Tony Blair zerstörte soziale Sicherungssysteme und zettelte an der Seite der USA den Irak-Krieg an. Der heutige Ministerpräsident Keir Starmer setzt auf eine neue Runde Sozialkürzungen, baut die Armee aus und lässt eine Gruppe, die zivilen Ungehorsam gegen Rüstungsfirmen praktiziert, als »terroristische Organisation« verfolgen.
»Gemeinsam gegen rechts« klingt immer richtig. Doch man muss überlegen, was im Mittelpunkt stehen sollte: die Mobilisierung gegen rechtsextreme Parteien oder die Mobilisierung gegen jene Prozesse der Entmenschlichung, die ihren Ursprung im Kapitalismus haben.
Die Linke in Großbritannien hat vermutlich gar keine andere Wahl, als es gegen Labour zu versuchen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







