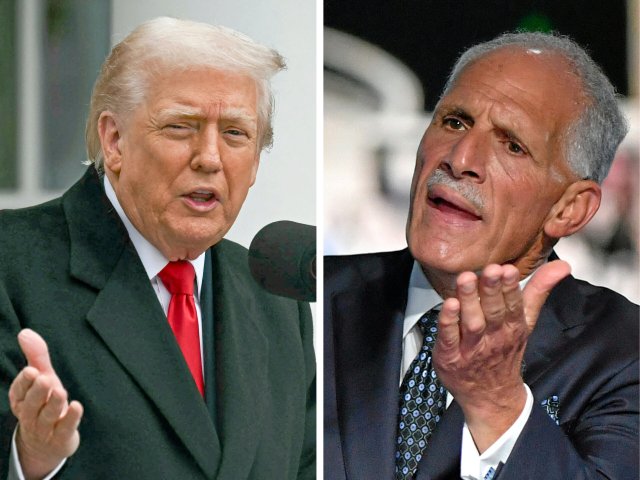- Kommentare
- Schwangerschaftsabbruch
Lage ungewollt Schwangerer: Erwartetes Armutszeugnis
Jana Frielinghaus über die Elsa-Studie zur Lage von Frauen, die eine Schwangerschaft beenden möchten

Es hat lange gedauert, bis die eigentlich seit fast zehn Monaten vorliegenden Ergebnisse der Studie zu Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse sind zugleich wenig überraschend und entsprechen dem, was in zahlreichen Medienbeiträgen der letzten Jahre detailliert geschildert wurde. Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen möchten, müssen demnach hohe Hürden überwinden, um den Eingriff in der gesetzlich möglichen Frist, also bis zur zwölften Woche nach der Empfängnis, vornehmen lassen zu können: Zwangsberatung, Bescheinigung, mindestens drei Tage Wartefrist danach, rauskriegen, wo der nächste Arzt ist, der bereit ist zu helfen, oft weite Wege.
All das in einer ohnehin psychisch sehr belastenden Situation. Denn in diesem sich so freiheitlich dünkenden Land ist die Entscheidung gegen ein weiteres Kind – die große Mehrheit der Betroffenen hat schon Nachwuchs – noch immer ein Tabuthema. Die Umgebung sieht allzuoft als »Sünde«, was eigentlich ein selbstverständliches Recht der Frau sein müsste: Selbst entscheiden zu können, ob und wie viele Kinder sie bekommt und sich nicht dafür rechtfertigen zu müssen. So leiden viele Betroffene unter Schuldgefühlen, sehen sich stigmatisiert.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen begünstigen die Tabuisierung ebenso wie die Tatsache, dass die Zahl der Ärzt*innen, die bereit sind, Schwangerschaften zu beenden, immer noch zurückgeht. Das zeigt, dass es mit der Streichung des Verbots, für Abtreibungen zu »werben«, aus dem Strafgesetzbuch nicht getan ist. Stattdessen wäre es höchste Zeit für eine vollständige Entkriminalisierung des Abbruchs, mindestens aber für eine Änderung des Pagrafen 218 StGB dahingehend, dass ein Abbruch bis zur zwölften Schwangerschaftswoche keine Straftat mehr wäre. So hat es eine Expertenkommission in ihrem Gutachten vom April 2024 empfohlen, so empfehlen es die Autoren der Elsa-Studie.
Doch ein Ende des Paragrafen ist unter einer unionsgeführten Bundesregierung nicht mehr in Sicht. Zugleich orchestriert die AfD, die mit religiös-fundamentalistischen Netzwerken von Abtreibungsgegnern eng vernetzt ist, Kulturkämpfe gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Die erfolgreiche Schmutzkampagne gegen die als Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf mit Falschbehauptungen auch zu ihrer Position zu Schwangerschaftsabbrüchen ist da nur die Spitze des Eisbergs.
Und selbst bei einer Teillegalisierung des Abbruchs könnten die Netzwerke weiter das Schwangerschaftskonfliktgesetz für sich instrumenalisieren. Denn danach dürfen sich Ärzt*innen aus Gewissensgründen weigern, Schwangerschaften zu beenden. »Lebensschützer*innen« agitieren bei Mediziner*innen seit Langem erfolgreich.
Dem steht im selben Gesetz die Pflicht der Bundesländer gegenüber, für ausreichend Angebote für ungewollt Schwangere zu sorgen. Die ist aber nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993 erfüllt, »wenn ärztliche Hilfe zum Abbruch der Schwangerschaft in einer Entfernung bereitsteht, die von der Frau nicht die Abwesenheit über einen Tag hinaus verlangt«. Danach ist die Durchschnittsentfernung von 130 Kilometern, die Betroffene laut Beratungsverein Pro Familia in Bayern zurücklegen müssen, völlig in Ordnung.
Bayern zählt zudem auch jene Kliniken in sein Angebot, die Abtreibungen nur nach medizinischer oder kriminologischer Indikation vornehmen, nicht aber nach »Beratungsregelung«. Dabei sind mehr als 95 Prozent der Abtreibungen solche nach Beratungsregel, also »rechtswidrig, aber straffrei«.
Dazu kommen im Rahmen der Krankenhausreform weitere Klinikschließungen und -fusionen, die das Angebot weiter ausdünnen dürften. Denn wie im Fall des Gynäkologen Joachim Volz werden weitere Häuser von katholischen Trägern übernommen, die gar keine Abbrüche anbieten. Und denen von Gerichten wie im Fall Volz bestätigt wird, dass sie ihren Angestellten untersagen dürfen, Abtreibungen vorzunehmen.
Es wäre mithin höchste Zeit, dass die Politik das Mindeste tut, nämlich das, was Carmen Wegge im Namen der SPD-Fraktion fordert: dass öffentlich finanzierte Kliniken verpflichtet werden, Abbrüche anzubieten, also auch konfessionelle, die öffentliche Mittel bekommen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.