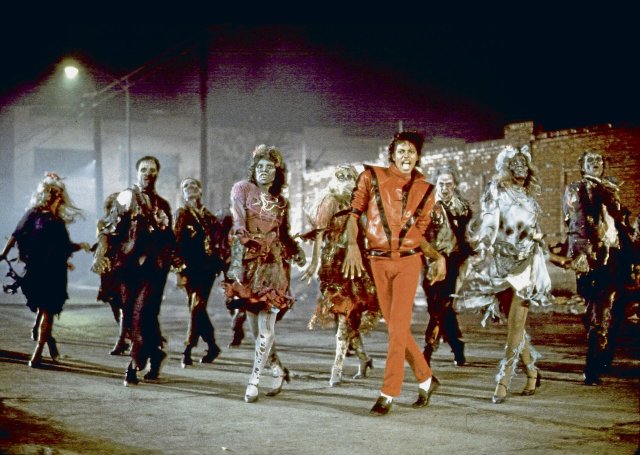- Kultur
- Hamburgische Staatsoper
Wie klingt Geld?
Der Multimilliardär Klaus-Michael Kühne will sich finanziell an einem Neubau für die Hamburgische Staatsoper beteiligen. Ein großzügiges Geschenk?

Es gibt Handlungsbedarf. Hamburgs Staatsoper muss generalsaniert werden. Oder – die Stadt baut sich ein neues Musiktheater. Klaus-Michael Kühne hat eine Förderung von 330 Millionen Euro für einen Neubau in Aussicht gestellt.
Wer ist der Mann? Nicht das erste Mal tritt Kühne, Jahrgang 1937, als Spender auf. Der Multimilliardär, der aus mutmaßlich steuerrechtlichen Erwägungen seinen Wohnsitz in der Schweiz hält, ist Erbe des Familienunternehmens Kühne und Nagel. Im Nationalsozialismus wurde der jüdische Anteilseigner Adolf Maass aus dem Unternehmen gedrängt. Bei der sogenannten M-Aktion profitierte Kühne und Nagel erheblich von der Entrechtung von Jüdinnen und Juden. Für die unzureichende Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte steht Klaus-Michael Kühne seit Jahren in der Kritik.
Der Unternehmer will beim künftigen Opernbau mitsprechen. Was die Wahl des architektonischen Entwurfs angeht und was den Ort betrifft. Letzterer ist auf das Baakenhöft in der Hafencity gefallen. Eine umstrittene Entscheidung.
Trotz der Beteiligung mit einem dreistelligen Millionenbetrag kämen aber auch auf die Hansestadt Kosten zu. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, beläuft sich der zu erwartende Anteil auf rund 250 Millionen Euro.
Aber sollte man es überhaupt so weit kommen lassen? Kulturbauten mit schmutzigem Geld finanzieren? Eine Privatperson an so weitreichenden Entscheidungen teilhaben lassen? Und muss es überhaupt so superlativ sein? Kein richtiges Kulturleben im falschen System.
Andererseits: Gibt es Geld, das nicht schmutzig ist? Kann man sich so viel Moral in Zeiten knapper Kassen leisten? Taugt ein gestifteter Opernbau wirklich als Entlastung von historischer Schuld in der Familie?
Marco Hosemann, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, ist Gegner eines Opernneubaus. Mit einer Petition richtet er sich gegen das umstrittene Vorhaben. In einem Positionspapier seiner Partei stellt er klar: »Wir brauchen nicht noch ein Wahrzeichen, sondern eine demokratische, geschichtsbewusste und nachhaltige Stadtentwicklung!«
Marco Hosemann, wann waren Sie zuletzt in der Hamburgischen Staatsoper?
Da war ich tatsächlich noch nie drin. Von außen kenne ich das Gebäude sehr gut, und ich bin auch in architektonischer Hinsicht großer Fan des Baus. Aber an Oper wurde ich nie herangeführt und habe dann auch nie selbst den Weg dahin gefunden.
Sie sind Teil einer Initiative, die sich gegen einen Opernneubau ausspricht, für den der Unternehmer Klaus-Michael Kühne eine Förderung in Aussicht gestellt hat. Bevor wir auf Herrn Kühne zu sprechen kommen, sagen Sie doch bitte: Was spricht gegen den Neubau, was – für eine Sanierung?
Ich finde, für einen Neubau spricht gar nichts. Wir haben in Hamburg bereits eine Staatsoper, die im Übrigen auch unter Denkmalschutz steht. Aus Untersuchungen, die die Stadt selbst in Auftrag gegeben hat, weiß ich, dass die Oper sanierbar ist und auch an veränderte Anforderungen angepasst werden kann. Ich kenne keinen einzigen Grund außer Größenwahn und dem Wunsch, unbedingt überall in der Champions League mitspielen zu wollen, der für einen Neubau spricht. An Vergleichen, wie sie etwa Kultursenator Carsten Brosda mit der Oper in Oslo zieht, merkt man, dass es nur um ein weiteres Wahrzeichen mit internationaler Aufmerksamkeit geht. Stattdessen sollte man sich zufriedengeben mit dem, was man hat, finde ich. Hinzu kommen auch ökologische Überlegungen: Man sollte sich in Zeiten des Klimawandels schon überlegen, was neu gebaut werden muss und was nicht.
Zumindest ein Nachteil einer Sanierung ist doch evident: Wenn saniert wird, wird der Spielbetrieb zeitweise unterbrochen oder nur eingeschränkt möglich sein. Ersatzspielstätten müssten gefunden werden.
Das ist durchaus ein Argument. Aber auch da würde ich einwenden, dass irgendwann, wie auch bei anderen Häusern, der Zeitpunkt einer Generalsanierung nun einmal gekommen ist. Daraus kann auch etwas Positives erwachsen: Der Sanierung des Deutschen Schauspielhauses haben wir immerhin Kampnagel als neue freie Spielstätte zu verdanken.
Auch wenn das nicht das Ziel sein muss, finde ich nicht, dass die notwendige Suche nach einem Interimsspielort schon für einen Neubau spricht, nur damit ja nicht der Spielbetrieb unterbrochen wird. Wenn man es nicht ganz blöd anstellt und die Sommerpausen einbezieht, wird sich das machen lassen. Aber auch eine vorübergehende Schließung und das Ausweichen auf einen anderen Ort bedeuten ja nicht den Tod der Hamburgischen Staatsoper.
Zu den ökonomischen Erwägungen, die für eine Sanierung sprechen: Gegner eines Neubaus nennen häufig etwaige Sanierungskosten in Höhe von 150 Millionen Euro. Die Zahl stammt aus einem Gutachten von 2020, also einer Zeit vor Energiekrise und Inflation. Gibt es eine Summe, die aus heutiger Sicht etwas realistischer ist?

Marco Hosemann, 1985 in Nordhorn geboren, ist stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, der er seit März 2025 angehört. Der gelernte Tischler und studierte Architekt ist außerdem seit letztem Jahr Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg-Nord.
Ich maße mir nicht an, eine seriöse Zahl nennen zu können. Aber natürlich sind die Baukosten seitdem gestiegen. Der Senat verfolgt bei seinen Neubauplänen eine Art Salamitaktik und gibt die möglichen Kosten nur stückweise bekannt. Mittlerweile heißt es, Hamburg würde sich mit 250 Millionen Euro am Neubau beteiligen. Wenn man die gestiegenen Baukosten betrachtet, läge man bei einer Sanierung wahrscheinlich trotzdem darunter.
Wenn eine Förderung in Höhe von 330 Millionen Euro in Aussicht gestellt wird, wie es Herr Kühne jetzt tut, wirkt es durchaus verlockend, das Geld einfach anzunehmen. Spricht nicht auch viel dafür?
Die meisten haben ja mittlerweile verstanden: Es geht hier nicht um ein Geschenk, sondern um eine Förderung. Auch wenn der Beitrag, den Herr Kühne dazugeben würde, nicht gering ist, wissen wir nicht, wie hoch die tatsächlichen Kosten für die Stadt sind. Wir kennen das ja bereits von der Elbphilharmonie. Wenn erst mal mit dem Bau begonnen wurde, zahlt die Stadt vielleicht doch drauf, damit weitergebaut wird.
Ich weiß, dass viele Menschen das anders bewerten, aber ich würde von diesem Mann kein Geld annehmen. Dieses Vermögen basiert auf Unrecht, auf Verbrechen, an denen Kühne und Nagel beteiligt war und die Klaus-Michael Kühne nie hat unabhängig und öffentlich aufarbeiten lassen.
Viele der großen Kulturhäuser in Deutschland sind ja von Fürsten erbaut worden oder von reichen Bürgern, privaten Unternehmern gestiftet worden. Dennoch ist es heute nicht so, dass die Stadtgesellschaft diese Einrichtungen mit diesen Stiftern in Verbindung bringen würde. Verkennt das Argument, es gehe hier um ein Denkmal für Herrn Kühne, nicht diese Tatsache?
Das glaube ich nicht. Auch wenn diese Institution in der Hafencity Hamburgische Staatsoper und nicht Kühne-Oper heißen würde – anders etwa als bei der Laiszhalle –, bin ich mir sicher, dass bei einem solchen Wahrzeichen bei jeder Stadtführung und bei jeder Barkassenfahrt an Klaus-Michael Kühne erinnert würde.
Man sollte nicht verkennen, dass es hier nicht einfach um eine gute Tat geht, sondern darum, dass Herr Kühne in den letzten Jahren auch vermehrt in der Kritik stand und er nun aber mithilfe seines Geldes gerne anders in Erinnerung bleiben möchte.
Wenn es die Absicht von Herrn Kühne war, mit dieser Förderung von der Unternehmensgeschichte von Kühne und Nagel in der Zeit des Nationalsozialismus abzulenken, ist dieser Plan zumindest nicht aufgegangen. Durch die Debatte um den Opernneubau wird so viel wie lange nicht über dieses Unrecht gesprochen.
Ja, mit dieser lautstarken Kritik wird er nicht gerechnet haben.
Nicht nur der Neubau im Allgemeinen, sondern auch der von Herrn Kühne dafür zur Bedingung gemachte Ort, der Baakenhöft, steht in der Kritik. Warum?
Der Baakenhöft war früher Handelsdrehscheibe für Kolonialwaren, aber auch der Ort, von dem aus Truppen und Waffen zur Niederschlagung des Widerstands der Herero und Nama transportiert wurden. Das war der erste Genozid im 20. Jahrhundert. Schon lange wird gefordert, dass hier etwas entsteht, das an dieses Verbrechen erinnert. An dieses letzte verfügbare Grundstück für eine öffentliche Nutzung am Baakenhafen gehört ein Erinnerungsort, keine Oper, die diese Geschichte überschreibt.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Aber es besteht die Gefahr, dass man am Ende beides nicht bekommt: keine Oper und keinen Gedenkort an historischer Stelle.
Auch über einen solchen Gedenkort und dessen genaue Gestaltung sollte meiner Meinung nach nicht allein der Senat entscheiden, sondern nur gemeinsam mit der Stadtgesellschaft. Auch darüber, was an einem solchen Ort zusätzlich entstehen kann, sollte gesprochen werden. Räume für Jugendkultur etwa. Es gibt sicher Nutzungen, die sich besser mit einem Gedenkort vereinbaren lassen, als es beispielsweise eine Oper könnte.
Aus Berliner Perspektive hat dieser Hamburger Streitfall auch etwas Merkwürdiges: Während in Berlin der Kulturetat zusammengekürzt wird, ist er in Hamburg sogar gestiegen. In Berlin stand ein Sanierungsstopp bei der Komischen Oper im Raum, was wohl der erste Schritt zur Abwicklung gewesen wäre. Mäzene und private Stifter sind hier, anders als in Hamburg, nur ein frommer Wunsch der Politik, aber nicht die Realität.
Es ist doch so: Wir könnten in Hamburg wahrscheinlich fünf Kühne-Opern bauen, wenn Klaus-Michael Kühne seine Steuern nicht in der Schweiz, sondern hier zahlen würde. Das lässt sich natürlich realpolitisch nur schwierig ändern. Ich finde es immerhin positiv an der gesamten Debatte, dass dieses Gebaren von Mäzenen und Stiftern auf diese Weise zum Thema wird.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.