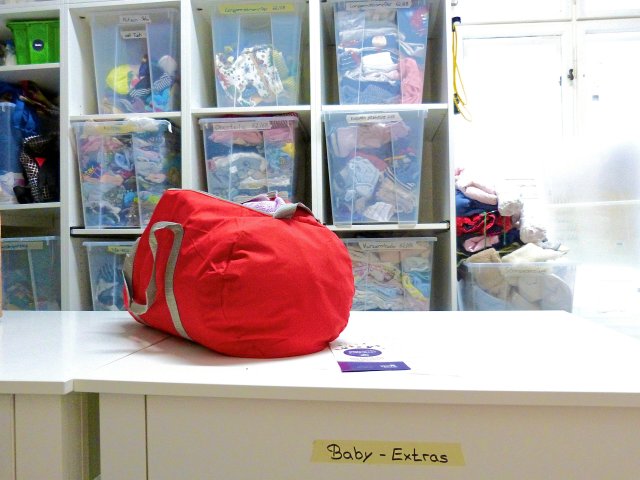- Berlin
- Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp
»Die Menschen fühlen sich wie Gäste in der eigenen Stadt«
Die Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp über Migration, Haushalt – und Gemeinsamkeiten mit Kai Wegner

Was, glauben Sie, verbindet Sie mit Kai Wegner?
Wir sind beide Berliner.
Mehr nicht?
Mehr fällt mir beim besten Willen nicht ein. Ich weiß nicht, ob Herr Wegner die gleichen Probleme hat, in einer Mietwohnung wohnt und auch mal Ärger mit dem Vermieter hat wie viele Berlinerinnen und Berliner und ich auch. Wenn ich mir seine Politik anschaue, folgere ich daraus, dass er die sozialen Realitäten in der Stadt nicht kennt, dass er das Leben der Menschen nicht kennt. Viele seiner Aussagen zur Sozialpolitik und Migrationspolitik finde ich spaltend und ausgrenzend. Mir geht es darum, die Menschen zusammenzuführen.
Im Abgeordnetenhaus nehmen viele Sie eher als konfrontativ wahr.
Ich würde eher sagen als starke Stimme für die Menschen in unserer Stadt. Herr Wegner macht eine konfrontative Politik gegen Arme, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte, gegen die Menschen, die hier jeden Tag hart arbeiten. Damit polarisiert er. Er macht ideologische Kürzungen bei den sozialen Trägern, missliebige Antidiskriminierungsprojekte werden weggespart. Dabei sind solche sozialen Projekte das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und am Görlitzer Park baut er einen Zaun, den die Anwohner nicht wollen.
Der Landesvorstand der Linkspartei nominierte Elif Eralp am 10. Oktober als Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im September 2026. Die 44-jährige Juristin lebt seit 2010 in Berlin. Nach Engagement in verschiedenen außerparlamentarischen Initiativen trat sie 2017 in Die Linke ein. Seit 2021 sitzt sie im Abgeordnetenhaus, dort ist sie Sprecherin für Antidiskriminierung ihrer Fraktion.
Auch am Görlitzer Park haben viele Menschen ein Problem mit Kriminalität und offenem Drogenkonsum. Wenn Sie von Zusammenhalt sprechen – wie wollen Sie die einbinden?
Natürlich wollen wir auch gegen Kriminalität und Gewalt vorgehen. Aber unser Ansatz ist vor allem präventiv, nicht repressiv. Und genau da streicht Schwarz-Rot gerade: bei der Täterarbeit, bei der Frauenberatung. Dabei wollen wir doch, dass Delikte gar nicht erst begangen werden. Ich denke da auch an den Görli: Wo sind denn da die Drogenkonsumräume? Den Leuten geht es doch vor allem darum, dass der Drogenkonsum nicht in ihren Hauseingängen stattfindet. Mit sicheren Orten zum Konsum könnte man das erreichen. Das ist das, was die Anwohnerinnen und Anwohner wollen und es hilft den Suchtkranken. Das ist ein verbindender Ansatz.
Können Sie sich das gerade schon vorstellen, dass Sie in knapp einem Jahr die Senatssitzungen leiten werden?
Na klar. Warum nicht?
Dafür muss Ihre Partei mitziehen. Beim jüngsten Landesparteitag hatte man den Eindruck, dass viele gar nicht regieren wollen.
Wir haben ganz viele neue Mitglieder und ich kann verstehen, dass sie hohe Ansprüche an eine Regierungsbeteiligung haben. Sie wollen, dass sich dann auch konkret etwas für die Menschen verbessert, wenn wir in die Regierung gehen. Es muss klar sein, dass der Vergesellschaftungsvolksentscheid umgesetzt wird. Es muss klar sein, dass wir die Mieten regulieren, damit die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Wenn das sichergestellt ist, bin ich mir sicher, dass die Partei mitziehen wird.
Das klingt ziemlich kompromisslos.
Natürlich müssen wir auch Kompromisse eingehen. Aber es ist klar – und ich glaube, das wird allen Beteiligten klar sein –, dass es so nicht weitergehen kann. Die Stadt wird unbezahlbar und die Menschen fühlen sich zunehmend wie Gäste in der eigenen Stadt. Natürlich werden wir über Wege streiten, wie man dem Einhalt gebieten kann, aber das muss das Ziel sein. Und ein paar Sachen sind demokratische Selbstverständlichkeiten, etwa dass man einen gültigen Volksentscheid auch umsetzt.
Ist das mit der SPD denn möglich? Die scheint sich in der Koalition mit der CDU eigentlich ganz wohl zu fühlen.
Ihr Spitzenkandidat macht ja gerade deutlich, dass er das Problem zumindest erkannt hat. Wenn man sich die Parteitagsbeschlüsse anschaut, ist die SPD eigentlich sozialer geworden. Sie hat viele Beschlüsse zur Mietenregulierung, bei der es große Schnittmengen mit uns gibt. Ich hoffe, dass dem Personal der SPD auch daran gelegen ist, diese Beschlüsse umzusetzen.
Sie lassen der SPD aber eine offene Flanke, um eine gemeinsame Regierung abzublasen: den laschen Umgang mit Antisemitismus in Ihrer Partei.
Ich habe mich mein Leben lang gegen Antisemitismus engagiert, zum Beispiel als ich das Berliner Gedenken an den Terroranschlag in Halle mitorganisiert habe. Wir setzen uns für die Sicherheit und die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Berlin ein. Genauso wie für die Sichtbarkeit muslimischen Lebens. Ich habe das Gefühl, dass es in Berlin gerade eine starke Polarisierung im Kontext des Kriegs in Gaza gibt, der jetzt hoffentlich endlich zu Ende ist. Diese Polarisierung möchte ich überwinden. Uns eint sehr viel. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Leid aller Betroffenen anerkennen. Herr Wegner macht das Gegenteil. Er zeigt keinerlei Empathie für die palästinensischen Menschen in unserer Stadt, die übrigens hier in Berlin ihre größte Community in ganz Europa haben. Er trifft sich nicht mit Angehörigen von Familien, die Verwandte im Krieg verloren haben, die getötet wurden durch das israelische Militär. Er legitimiert Polizeigewalt, die auf Demonstrationen stattfindet, wenn Menschen ihre Verzweiflung und Wut über Kriegsverbrechen zum Ausdruck bringen. Man muss sich das Leid aller Seiten anhören. Dabei ist klar: Antisemitismus dulden wir nicht.
Aber wenn man sich den Bezirksverband Neukölln anguckt: Da wird ein Bürgermeister einer israelischen Stadt von Vertretern Ihrer Partei in der Bezirksverordnetenversammlung als »Völkermörder« beschimpft und man weigert sich, eine Resolution zu unterstützen, die den von Morddrohungen betroffenen Betreibern der Kneipe »Bajszel« die Solidarität ausspricht.
Demokratischen Protest gegen Politiker der Partei von Netanjahu finde ich legitim, aber die Form und die Wortwahl teile ich ausdrücklich nicht. Und ich hätte es sehr richtig gefunden, diese Resolution zu unterstützen und den Betreibern des »Bajszel«, die Morddrohungen erhalten haben, wo es antisemitische Übergriffe gab, klar die Solidarität auszusprechen. Das ist unsere Linie und deswegen sind wir mit den Beteiligten auch im Gespräch.

Noch einmal zur möglichen Koalition mit der SPD: Freuen Sie sich darauf, bald die Chefin von Innensenatorin Iris Spranger zu werden?
Klar.
Vieles, was Frau Spranger macht, ist das Gegenteil dessen, was Sie als antidiskriminierungspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion vertreten. Berlin schiebt gerade wieder verstärkt Roma und Sinti nach Moldawien ab, auch Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan werden wieder abgeschoben. Würde das unter Ihnen weitergehen?
Das kann so nicht weitergehen. Was gerade von der schwarz-roten Koalition im Bund kommt, ist einfach nur Kaltherzigkeit, ist Spaltung der Gesellschaft. Menschen wie mir wird gesagt, sie gehörten nicht zum Stadtbild. Und dann wird ein bisschen zurückgerudert. Das ist AfD-Masche, das finde ich unter aller Kanone. Und auch rassistisch. Berlin muss das Gegenmodell zu dieser Politik sein.
Was heißt das?
Das Aufenthaltsgesetz ist Bundessache, aber es gibt Auslegungsspielräume und die müssen wir nutzen, damit möglichst viele Menschen hier bleiben können. Deren Kinder sind ja hier und gehen hier auf die Schule. Deswegen haben wir Vorschläge gemacht für ein Bleiberecht, auch aus historischer Verantwortung. Roma und Sinti sind Opfer eines Genozids in der NS-Zeit geworden. Deswegen sollten sie ein Bleiberecht bekommen und dafür sollten wir uns auf Bundesebene einsetzen. Die Abschiebezahlen haben mit Schwarz-Rot enorm zugenommen.
Ende November soll das Ankunftszentrum Tegel leer sein. Wie soll es dann weitergehen?
Tegel ist eine der größten und auch eine der inhumansten Unterkünfte ganz Deutschlands – und dazu noch sehr teuer. Wir möchten, dass die Geflüchteten Zugang zu Wohnungen haben und dass sie übergangsweise dezentral in standardwahrenden Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden.
Aber bevor die Menschen auf dezentrale Unterkünfte verteilt werden, müssen sie ja erst mal irgendwo erstuntergebracht werden. Viel spricht dafür, dass das bald in der Karl-Bonhoeffer-Klinik in Reinickendorf passieren könnte.
Aus meiner Sicht ist das Wichtigste gar nicht der konkrete Standort, sondern dass dort humane Standards gewahrt werden. Es muss ein Clearingverfahren geben, die besondere Vulnerabilität von Menschen muss festgestellt werden. Also: Sind die Menschen schwanger, chronisch erkrankt und so weiter? Und dann müssen die Menschen entsprechend in die Unterkünfte verteilt werden, dieser Verteilprozess sollte möglichst kurz sein. Ob die Karl-Bonhoeffer-Klinik der beste Standort dafür ist, müssen wir dann eruieren.
Und das gemeinsame Ausreisezentrum mit Brandenburg?
Das wird es mit mir nicht geben.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die CDU will angesichts sinkender Flüchtlingszahlen Unterkünfte in Studierendenwohnheime umwandeln. Können Sie sich dafür erwärmen?
Ich finde es falsch zu sagen, dass man alles abbaut, weil die Zahlen jetzt sinken. Wenn es etwa in der Ukraine wieder eine größere Fluchtbewegung gibt, dann steht man blank da und manövriert sich selbst in eine Notlage. Man muss die Strukturen so aufstellen, dass jederzeit auch größere Fluchtbewegungen bewältigt werden können. Darum können wir keine Kapazitäten abbauen. Natürlich müssen auch Studierendenwohnheime geschaffen werden und vieles mehr. Aber wir können jetzt nicht die Unterkünfte schließen und einfach hoffen, dass niemand mehr kommt.
Der Zielkonflikt bleibt ja aber. Gebäude und Flächen, die für Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden, können keine andere Funktion erfüllen.
Studierende und andere Berliner sollten einen besseren Zugang zu Wohnungen darüber erhalten, dass man die Mieten reguliert. Es ist ja nicht so, dass es gar keinen Wohnraum gibt, es gibt nur sehr viel teuren Wohnraum. Und es wird nicht genug bezahlbar gebaut. Deswegen wollen wir, dass große Vermieter eine Sozialquote erfüllen müssen, also mindestens jede dritte Wohnung bezahlbar vermieten müssen. So könnten jedes Jahr 13 000 Wohnungen bezahlbar werden. Und wir wollen stärker gegen illegale Ferienwohnungen vorgehen. Das ist doch absurd: Die Hälfte der Hotelbetten in Berlin steht leer, während Touristen in Wohnungen übernachten. Dafür sind Wohnungen aber nicht da, sondern für die Menschen in unserer Stadt.
Aber es braucht ja auch Neubau.
Mit unserem kommunalen Wohnungsbauprogramm sollen jährlich mindestens 7500 bezahlbare Wohnungen entstehen. Wir wollen, dass der Neubau der Landeseigenen abgekoppelt wird von der Bewirtschaftung der aktuellen Wohnungen. Gerade müssen die Landeseigenen den Neubau aus den Mieten finanzieren. Das setzt sie unter Druck, die Mieten zu erhöhen. Deswegen sollte es einen Landeszuschuss nur für den Neubau geben, damit die Landeseigenen Kredite aufnehmen können, um so ihre Bauvorhaben zu finanzieren. Wir denken da an etwa eine Milliarde Euro im Jahr.
Aber die Zinsen für diese Kredite müssten dann ja auch wieder aus den Mieteinnahmen finanziert werden.
Wohnen gehört wie Schule, Bildung oder Gesundheitsversorgung zur Daseinsvorsorge. Es geht zuallererst um das Zuhause von Menschen und nicht um ein rentables Geschäft. Da muss der Staat auch bereit sein, Geld reinzugeben.
Wenn man dem Bausenator Christan Gaebler zuhört, könnte man meinen, dass die Linkspartei in der rot-grün-roten Senatszeit nichts anderes gemacht hat, als Neubau zu verhindern. Hat er recht?
Unter der linken Bausenatorin Katrin Lompscher sind die meisten Wohnungen genehmigt und gebaut worden. Wir sind nicht diejenigen, die Neubau verhindert haben. Das ist einfach falsch. Wir sind sehr wohl für den Neubau, aber eben nicht für Luxusneubau. Wohnungen, die sich kein Mensch leisten kann, bringen uns nichts. Nur ein Beispiel, wo der Senat aktuell untätig bleibt: In der Stadt gibt es unzählige unbebaute Flächen, die von Investoren zu Spekulationszwecken gehalten werden. Wir wollen, dass dafür eine Extrasteuer erhoben wird, damit sich das nicht mehr rechnet.
Man sieht Linke aber oft im Widerstand gegen Großbauprojekte.
Wir brauchen natürlich neue Siedlungen und es ist mitnichten so, dass wir uns gegen alle diese Projekte stemmen. Häufig geht es aber um die Art und Weise der Bebauung. Oft ist nur ein kleiner Teil der geplanten Wohnungen für Mieter mit niedrigen Einkommen vorgesehen.
In Marzahn-Hellersdorf macht ihre Genossin Katalin Gennburg dagegen mobil, dass eine Bowlingbahn abgerissen wird, damit ein Hochhaus entstehen kann. Sind Bowlingbahnen wirklich wichtiger als Wohnraum?
Ich wünsche mir, dass man das nicht gegeneinander ausspielt. Denn die Leute brauchen auch eine soziale Infrastruktur, ob es eine Bowlingbahn ist oder eine Kiezkantine. Diese Orte sind wichtig. Aber es muss natürlich im Einzelfall abgewogen werden. Man muss vor Ort gucken, was die Priorität sein muss.
Wie wollen Sie die geplante Vergesellschaftung von hunderttausenden Wohnungen finanzieren?
Die Initiative geht davon aus, dass sich das über einen längeren Zeitraum refinanzieren lässt. Nach unseren Berechnungen würde das den Haushalt nicht massiv zusätzlich belasten, man würde das in Raten abbezahlen und gleichzeitig kommt ja Geld über die Miete rein. Die Mietenkrise ist die soziale Frage unserer Zeit, daher sind dauerhaft bezahlbare Wohnungen in kommunaler Hand eine sinnvolle Investition. Rekommunalisierte Wohnungen senken den Mietspiegel und tragen so dazu bei, dass die Stadt für alle bezahlbarer wird.
Berlin steckt ohnehin in einer Haushaltskrise. Wie wollen Sie die lösen?
Zum einen wollen wir mehr Schulden aufnehmen. Das hat Schwarz-Rot lange abgelehnt, aber jetzt machen sie es auch. Aber wir sagen auch ganz klar: Wir müssen die Einnahmeseite stärken. Beispielsweise prüfen wir gerade eine Luxusvillensteuer. Wer sich eine Villa für vier Millionen Euro leisten kann, der kann sich auch stärker am Gemeinwohl beteiligen. Zudem wollen wir auch an die Grunderwerbssteuer ran. Würde man sie auf das Brandenburger Niveau erhöhen, wären das alleine schon etwa 70 Millionen Euro. Der größte Skandal ist aber, dass der Bund untätig ist, was die Vermögenssteuer betrifft. Allein Berlin sind dadurch seit 1997 rund 20 Milliarden Euro entgangen. Falls der Bund da weiter nichts macht, wollen wir prüfen, ob Berlin nicht eine eigene Vermögenssteuer erheben kann.
Aber würde es nicht Jahre dauern, ein solches Instrument zu prüfen, es im Bundesrat durchzukämpfen und dann zu implementieren?
Ja. Aber andere Dinge kann Berlin sofort umsetzen, zum Beispiel die Vergnügungssteuer oder die Erhöhung der City-Tax.
Das würde doch nicht reichen, um das Finanzloch zu stopfen.
Wir wollen alle Möglichkeiten nutzen und auch die Prioritäten entsprechend setzen. Man muss gemeinsam mit der Zivilgesellschaft einen Weg finden, wie Kosten reduziert werden können. Ich denke da zum Beispiel an das Zuwendungsrecht. Wie viele Bürokratiekosten entstehen alleine dadurch, dass Jahr für Jahr die Träger über ihre Projekte Rechenschaftsberichte verfassen müssen und dass die Behörden die Projektanträge prüfen müssen? Das sollte lieber in die Arbeit investiert werden.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.