- Politik
- Linke-Anfragen
Statistik des BKA: Deutlich weniger antisemitische Straftaten
Von Landeskriminalämtern gemeldete Zahlen haben sich seit Jahresbeginn halbiert

»Kein Ende in Sicht«, schreiben die Grünen-Politiker*innen Katrin Göring-Eckardt, Marlene Schönberger und Omid Nouripour diese Woche in einem Gastbeitrag für die »Jüdische Allgemeine«. Sie betonen darin, der Antisemitismus sei in Deutschland »in den vergangenen zwei Jahren eskaliert« und stelle ein anhaltendes Problem dar – so sehen es auch viele Linke. Bei den Straftaten bestätigt sie sich jedoch nicht: Quartalsanfragen der Linksfraktion zeigen vielmehr deutlich sinkende Zahlen beim Bundeskriminalamt (BKA).
Die jüngste Antwort des Bundesinnenministeriums zu antisemitischen Straftaten wurde in dieser Woche veröffentlicht. Für das dritte Quartal 2025 meldeten Landeskriminalämter der Bundesländer 602 solcher angezeigten Delikte an das BKA. Im ersten Quartal waren es noch 1047, im zweiten 899. Viele Fälle betreffen Volksverhetzung, etwa Aufrufe zu Gewalt gegen Jüd*innen oder Holocaustleugnung. Hier stehen 229 Fällen aus dem dritten Quartal 422 aus dem ersten Quartal gegenüber. Auch antisemitisch motivierte Gewalttaten gingen zurück: Aktuell wurden 18 verzeichnet, bei denen acht Menschen leicht verletzt worden waren. Anfang des Jahres waren es noch 27 Fälle dieser Art.
Die Angaben stammen aus dem Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK). Das BKA sortiert die Delikte in die fünf Phänomenbereiche Rechtsextremismus, Linksextremismus, ausländische beziehungsweise religiöse Ideologie sowie »Sonstige Zuordnung« ein. Stichtag der aktuellen Zählung war der 30. September. Oft wird eine Tat erst nach Ermittlungen durch die Länderpolizei als antisemitisch eingestuft, weshalb die Zahlen regelmäßig aktualisiert werden. Für das erste Quartal 2025 weist die Fallzahlendatei inzwischen 1264 antisemitische Straftaten aus – rund ein Viertel mehr als zunächst gemeldet.
Endgültige Jahreszahlen liegen stets erst im Folgejahr vor. Für 2024 zeigen sie einen Anstieg nach Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023, gefolgt von einem deutlichen Rückgang zum Jahresende. Insgesamt wurden 6560 antisemitische Straftaten gemeldet, darunter 178 Gewalttaten, 3128 Volksverhetzungen und 1 438 Propagandadelikte. Unter Letzteren dürften zahlreiche Verstöße im Zusammenhang mit der Parole »From the river to the sea, Palestine will be free« fallen, die von der damaligen SPD-Innenministerin Nancy Faeser kurz nach dem 7. Oktober 2023 der Hamas zugeordnet und verboten worden war.
Wie Antisemitismus definiert wird, ist politisch umstritten – und beeinflusst auch die Statistik des BKA.
In den Kleinen Anfragen lässt sich die Linksfraktion auch regelmäßig über Ermittlungserfolge informieren. Zu den 602 Straftaten des dritten Quartals 2025 wurden bislang 258 Tatverdächtige identifiziert und sechs Personen festgenommen; Haftbefehle wurden noch nicht erlassen. Auch diese Zahlen steigen stets im Zuge nachträglicher Ermittlungen. Für das erste Quartal werden mittlerweile 617 Tatverdächtige geführt – etwa die Hälfte in Bezug zu den Fallzahlen.
Warum die gemeldeten Delikte so deutlich zurückgehen, lässt sich den Regierungsantworten nicht entnehmen. Der Antisemitismusforscher Peter Ullrich verweist auf eine mögliche, »sich abzeichnende Entspannung im Nahost-Konflikt oder Hoffnung darauf« und ein rückläufiges Protestgeschehen, wodurch weniger »Gelegenheiten« für einschlägige Delikte entstünden. Dies erklärt jedoch nicht, warum die Zahlen bereits im zweiten Quartal 2025 deutlich sanken.
Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, nennt gegenüber »nd« dagegen »repressive Maßnahmen, Ermittlungserfolge und strafrechtliche Verurteilungen«, die Wirkung zeigten. Sensibilisierungs- und Präventionsmaßnahmen hätten zudem »Delikte bereits im Vorfeld verhindert«.
Klein sieht die Hauptquelle weiterhin im »Einfluss des Nahost-Konflikts«. Die Regierungszahlen stützen diese Einschätzung aber kaum. Im dritten Quartal wurden 98 antisemitische Straftaten dem Phänomenbereich »rechts« zugeordnet, 96 »ausländischer Ideologie«, 36 »religiöser Ideologie«, 25 »Sonstige« und drei »links«. Auffällig ist eher der deutliche Rückgang als »rechtsmotiviert« eingestufter Delikte; im ersten Quartal machten sie noch etwa die Hälfte der Gesamtzahl aus.
Katrin Fey, auf deren Anfrage hin die aktuellen Zahlen veröffentlicht wurden, sieht den Fokus den Nahost-Konflikt kritisch. »Nicht hilfreich ist, legitime und notwendige Proteste gegen Kriegsverbrechen in Gaza und gegen illegale Siedlergewalt im Westjordanland als antisemitisch zu stigmatisieren und zu kriminalisieren«, sagt die Linke-Abgeordnete »nd«. Sie fordert mehr Bildungsarbeit und Aufklärung sowie den Schutz jüdischer Menschen davor, »für die Verfehlungen der aktuellen israelischen Regierung verantwortlich gemacht zu werden«.
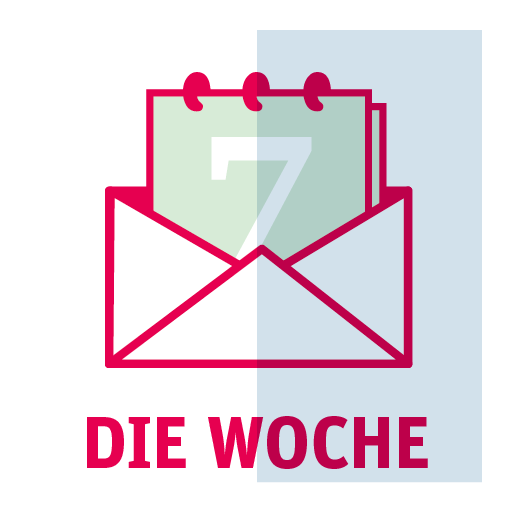
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
»Die Gesamtlage bleibt angespannt«, erklärt Klein trotz der halbierten Fallzahlen und verweist auf eine »grundsätzliche Radikalisierung und Veränderung von Erscheinungsformen des Antisemitismus nach dem 7. Oktober 2023«. Eine fundierte Bewertung sei erst möglich, wenn auch die von der Bundesregierung finanzierte Meldestelle Rias ihre Daten vorlegt – sie zählt auch »Vorfälle«, die nicht strafbar sind.
Wie Antisemitismus definiert wird, ist politisch umstritten – und beeinflusst auch die Statistik des KPMD-PMK. So hat die Linke auf ihrem Parteitag im Mai die »Jerusalemer Erklärung« als Definition beschlossen, da ihr zufolge oft auch legitime Israel-Kritik als antisemitisch eingeordnet werde. Rias hingegen nutzt die Definition der »International Holocaust Remembrance Alliance« (IHRA), die auch der Bundestag anerkannt hat und die leicht zur Diskreditierung legitimer politischer Kritik herangezogen werden kann.
Rias regt an, die IHRA-Definition auch in der Strafverfolgung verstärkt zu berücksichtigen. Dies ist eine der Empfehlungen des Projekts »Austausch von Polizei und Zivilgesellschaft zu Antisemitismus« (APZAS), dessen Abschlussbericht die Organisation jetzt vorgelegt hat. Dadurch könnte sich der Ermessensspielraum der Ermittlungsbehörden verschieben: würden mehr »israelbezogene Vorfälle« als antisemitisch eingestuft – stiegen die BKA-Fallzahlen wieder.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.






