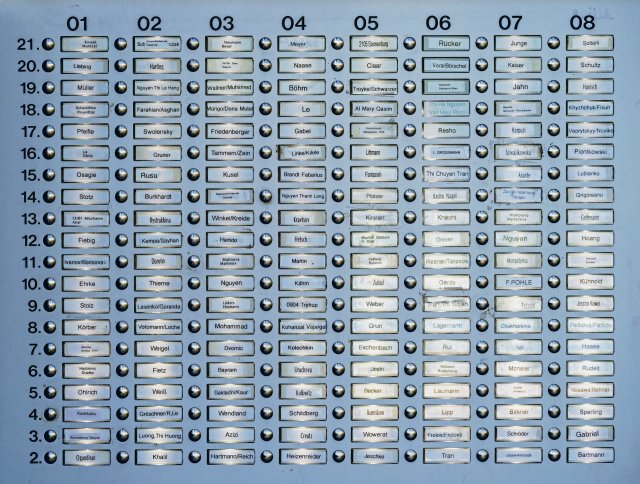Macron baut auf das Machbare
Sebastian Dullien über interne Strukturreformen, die Frankreich benötigt und deutschen Flankenschutz
Ist mit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron die Zeit von linken Experimenten in der Wirtschaftspolitik à la Mitterrand 1981 und Hollande 2012 endgültig vorbei? Steht Macron für das noch Machbare im Zeitalter der Hegemonie der Finanzmärkte?
Ob das noch Machbare schlechter ist als die linken Experimente, ist nicht zwingend ausgemacht. Dies gilt insbesondere in Bezug auf François Hollande. Da ging es sehr viel um Symbolpolitik und viel weniger um das, was wirklich bei den bedürftigen Menschen ankommt. Demgegenüber hat François Mitterrand seiner Wirtschaftspolitik durchaus makroökonomische Gesamtzusammenhänge zugrunde gelegt und relevante Sachen versucht. Bei Hollande ging es etwa um die Reichensteuer, die aber ohnehin weder besonders viel Einnahmen gebracht noch besonders viele Leute getroffen hat. Vielleicht ist es ganz gut, wenn Frankreich nun einen Präsidenten hat, der zumindest das links progressiv Machbare versucht, anstelle sich wie Hollande in Symbolpolitik zu verlieren.
Mitterrand kann man Symbolpolitik nicht vorwerfen. Er hat 1981 mit ambitionierten linken Ansätzen begonnen, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit einer nachfrageorientierten Wirtschafts- und Sozialpolitik, Ausbau öffentlicher Dienste, deutliche Anhebung des Mindestlohnes etc. pp. Klingt sozial progressiv, gibt es theoretisch einen Haken?
Mitterrand war ein dezidiert Linker. Jedoch gilt auch für linke Politiker, dass man in einer Volkswirtschaft nicht mehr verteilen kann als produziert wird. Das gilt insbesondere in einem System fester Wechselkurse bei weitgehend freiem Handel von Waren und Dienstleistungen wie es damals mit dem Europäischen Währungssystem (EWS) in Europa vorherrschte. Was Mitterrand damals übersehen hat, waren die Grenzen, die ihm die Märkte gesetzt haben: Weder lässt sich unbegrenzt die Binnennachfrage ankurbeln, wenn dies mit steigender Inflation einhergeht, noch lässt sich unbegrenzt Kapital leihen, weil in offenen Kapitalmärkten die Kreditwürdigkeit nicht zuletzt an der Währungsstabilität festgemacht wird, die durch Inflation beeinträchtigt wird. Frankreichs Inflationsraten lagen damals deutlich über Deutschlands, des wichtigsten Handelspartners.
Sebastian Dullien ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin sowie Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations. Frankreich ist er seit einem Auslandsstudium besonders verbunden. Mit Dullien sprach Martin Ling.
Mitterrands brach sein Experiment nach zwei Jahren ab, regierte noch bis 1995. Die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik wurde durch eine im Kern Sparpolitik ersetzt, das sogenannte sozialistische Experiment beendet, die Politik des Wechsels durch die Politik der Strenge ersetzt. Nachvollziehbar?
Ja. Der Versuch einer einseitigen Ausweitung der Nachfrage über höhere Staatsausgaben und höhere Verschuldung kann nicht funktionieren, wenn Frankreich einen festen Wechselkurs mit einem Land wie Deutschland hat, das auf niedrige Inflationsraten setzt. Das Ergebnis ist und war ein Ausweiten der Handelsdefizite und ein Anstieg der Auslandsverschuldung Frankreichs. Das ist auf Dauer nicht tragfähig. Das hat Mitterrand damals erkannt und daraufhin einen Politikwechsel eingeleitet.
Welche Rolle spielte in dem Zusammenhang das EWS?
Das EWS hat einer »autonomen« Wirtschaftspolitik externe Grenzen gesetzt. Das EWS legte feste Wechselkurse in engen Bandbreiten fest. Das bedeutete, dass sich höhere Inflationsraten als bei den Nachbarländern automatisch in einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit niederschlugen und zu wachsenden Außenhandelsdefiziten beitrugen. Der Spielraum für Handelsungleichgewichte war im EWS sogar noch geringer als heutzutage in der Euro-Zone. Damals musste bei Handelsdefiziten abgewertet werden, was heutzutage durch den Euro nicht mehr geht. Stattdessen werden die Defizite über den Interbankenmarkt und Target-Salden der Notenbanken abgepuffert. Über das Target-System werden grenzüberschreitende Zahlungen zwischen den Notenbanken abgewickelt. Im EWS mussten Außenhandelsdefizite direkt über Kreditaufnahme im Ausland finanziert werden, was den Defiziten engere Grenzen setzte als in der Euro-Zone.
Lässt sich die These vertreten, dass Frankreich schon 1981 keinen geld- und währungspolitischen Kurs fahren konnte, der dem von Deutschland diametral entgegengesetzt ist?
Das lag im Wesen des EWS. Das Festkurssystem in Kombination mit annähernd freiem Handel und freiem Kapitalverkehr verschließt den Spielraum für inländische Geld- und Fiskalpolitik weitgehend. Mitterrand hat trotzdem versucht, eine eigene von Deutschland abweichende Geld- und Fiskalpolitik zu machen, und das ging schief. Es gab eine gewisse Asymmetrie im EWS. Es gab die deutsche Bundesbank mit der starken D-Mark und die Bundesbank hat immer gesagt, dass Geldwertstabilität für sie Priorität habe und sie, nur so lange das nicht gefährdet sei, auch das EWS unterstützen würde. Von daher mussten sich die anderen Länder an der Geldpolitik der Bundesbank orientieren und auch die Zinsbewegungen mitmachen. Da blieb dann eben Frankreich auch nicht viel anderes übrig, als dem zu folgen.
War deswegen Mitterrand für die Einführung einer europäischen Währung?
Durchaus. Diese Erfahrung der Abhängigkeit von der Politik der Bundesbank war ein wesentlicher Grund, warum Frankreich so auf eine Europäische Zentralbank und den Euro gepocht hat. Es gab die Hoffnung, dass eine Europäische Zentralbank den Zins nicht nur mit Blick auf die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, sondern mit Blick auf die Interessen der gesamten Währungsunion setzen würde.
Was der aktuelle Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zum Verdruss von Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, durchaus macht.
Genau. Das ist tatsächlich der Fall und das ist richtig bei einer Zentralbank, die für den ganzen Währungsraum Verantwortung hat.
Der erste, der nach Mitterrand 1981 wieder mit einem dezidiert linken Wirtschaftsprogramm Wahlen gewann, war 2012 François Hollande. Er kündigte eine Sondersteuer für Reiche in Höhe von 75 Prozent an, er erklärte Banken und Großfinanz zu seinem »eigentlichen Gegner« und er verhieß ein anderes Europa: weniger sparsam und weniger deutsch, mit mehr Ausgaben für Wachstum und Jobs. Warum ist daraus nicht viel geworden?
Ich würde der These widersprechen, dass Hollande vom Anspruch die erste dezidiert linke Regierung seit Mitterrand war. Es gab von 1997 bis 2002 die linke Regierung des Premiers Lionel Jospin während der Präsidentschaft des Konservativen Jacques Chirac. In Frankreich ist der Präsident vor allem für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig und der Premierminister vor allem für Wirtschafts- und Innenpolitik. Was Jospin damals gemacht hat, ist aller Ehren wert: Das war wesentlich progressiver und erfolgreicher als die Regierungszeit unter François Hollande. In Jospins Zeit fiel die Umsetzung der 35-Stunden-Woche, fielen die so genannten Emploi Jeune, das waren große Beschäftigungsprogramme für arbeitslose Jugendliche, die etwa zu Nachmittagsbetreuungen in Schulen eingesetzt wurden und Ähnliches. All das wurde damals umgesetzt und war relativ erfolgreich. Damals ist die französische Wirtschaft schneller gewachsen als die deutsche.
Warum ist Hollande gemessen an seinem Programm so krachend gescheitert?
Vor allem weil er sein wichtigstes Versprechen nicht umgesetzt hat: Deutschlands Austeritätskurs für die Euro-Zone zu brechen. Mehr als ein paar verbale Vorstöße am Anfang gab es nicht. Hollande ruderte schnell zurück, als er einerseits merkte, dass er außenpolitisch auf Widerstände stößt, und andererseits ihm innenpolitisch das politische Kapital fehlte, um einen Konflikt mit Deutschland zu wagen. Für einen Teil seiner Vorschläge hätte es bestimmter Änderungen am Lissabon-Vertrag bedurft, die nicht ohne neuerliches Referendum zu haben gewesen wären. Das wollten Teile der gespaltenen sozialistischen Partei auf jeden Fall vermeiden. Hollande hat sein Versprechen in sehr ferne Zukunft verschoben.
Europa, präziser die Europäische Union zu reformieren, gehört auch zu den Oberzielen von Emmanuel Macron. Ob er sein Programm umsetzen kann, hängt von vielen Unwägbarkeiten wie den Ergebnissen der Wahlen zur Nationalversammlung im Juni, aber auch dem zu erwartenden Widerstand von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen gegen weitere Arbeitsmarktderegulierung ab. Davon abgesehen: Wie schlüssig ist sein wirtschaftspolitisches Konzept theoretisch, im Kern eine Senkung von Ausgaben in Kombination mit Wachstumsimpulsen?
Im Kern handelt es sich um ein ausgewogenes und vernünftiges Programm, das gewisse Verbesserungen auf der Angebotsseite beinhaltet, aber gleichzeitig dafür sorgen will, dass von der makroökonomischen Seite die Nachfrage angekurbelt wird und damit Jobs geschaffen werden können. Das Programm ist wesentlich ausgeglichener als das, was Deutschland unter Kanzler Gerhard Schröder von 2003 bis 2005 mit der Agenda 2010 umgesetzt hat. In Deutschland wurden damals Strukturreformen mit Austerität kombiniert. Das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass es relativ lange gedauert hat, bis die Wirtschaft aus dem Tief kam. Macron setzt stärker auf Nachfrage, das scheint ein sinnvollerer Ansatz zu sein.
Frankreich hat aus dem Blickwinkel der globalen Standortkonkurrenz und im Vergleich der EU-Zone Reformbedarf. Wo drückt der Schuh?
Der Privatsektor steht stark unter Druck. Die Lohnstückkosten liegen deutlich über denen von Deutschland, zum Beispiel in der Autoindustrie. Die Löhne wurden über dem Niveau der Produktivitätssteigerungen angehoben und damit international an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Zudem ist der Staatssektor teils ziemlich aufgebläht. Zwar ist die Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge in Frankreich ziemlich gut, aber man hat nicht den Eindruck, dass sie so gut ist, dass man dafür zehn Prozent mehr des Bruttoinlandsprodukts ausgeben sollte, als das in Deutschland der Fall ist. Da ist durchaus Spielraum, Strukturen effizienter zu machen und zu verbessern. Auch die öffentlichen Investitionen sind im Keller - ähnlich wie in Deutschland. Gerade da wäre ein Umsteuern angesagt, also weniger konsumtive Staatsausgaben und mehr Staatsausgaben in Bildung und Infrastruktur.
Abschließende Frage: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat kürzlich gesagt, Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es auch Europa gut geht. Deutschland geht es relativ gut, Europa in weiten Teilen nicht. Was liegt in der Verantwortung von Deutschland, eben dieses Ungleichgewicht und dieses Missverhältnis zu verändern?
Die Austeritätspolitik in der Staatsschuldenkrise in der Euro-Zone ging sehr stark auf deutsches Drängen zurück. In der Krise nach 2012/13 haben die EU-Staaten noch mal extra gespart und gekürzt, was die Rezession noch schlimmer gemacht hat. Von diesem Kurs müsste Deutschland abrücken, Anzeichen dafür gibt es. Deutschland müsste Institutionen und Möglichkeiten schaffen, dass Krisenländer Investitionen erhöhen können, um die Arbeitslosigkeit schneller senken zu können. Und Deutschland ist auch gefragt, tatsächlich den Leistungsbilanzüberschuss abzubauen, denn der ist eine Belastung nicht nur für den Rest Europas, sondern auch für die Weltwirtschaft. An ihm zeigt sich, wie sehr Deutschland vom Euro profitiert hat. Laut Finanzminister Wolfgang Schäuble im »Spiegel« wäre der deutsche Überschuss wahrscheinlich nur halb so groß ohne den Euro. Der Gewinn durch den Euro entspricht ungefähr 1,7 Millionen Arbeitsplätzen in Deutschland. Der Überschuss muss deswegen mit Bedacht abgebaut werden. Mehr im Inland investieren und dadurch auch mehr importieren. Das würde Macron Luft verschaffen.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.