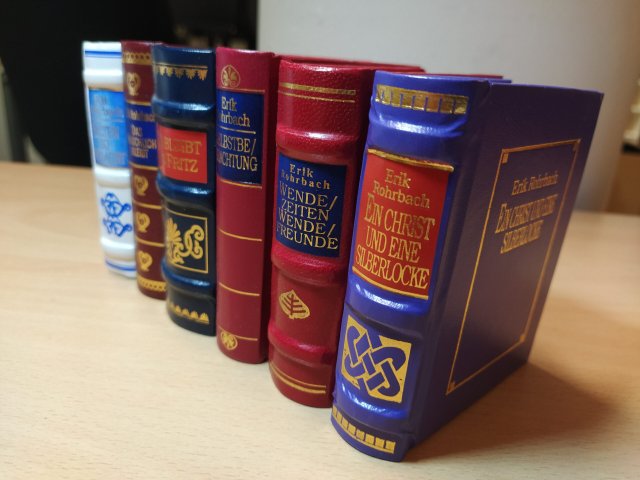- Berlin
- Wasserkreislauf
Berlin: Vom Graben in die Trinkflasche
Wasserbetriebe erproben Sickerschlitze am Standort Johannisthal

Ein Graben im Boden, einen Meter breit und 25 Meter lang, mit einer Metall-Abdeckung versehen: Der sogenannte Sickerschlitz der Berliner Wasserbetriebe sieht nicht allzu spektakulär aus. Durch den sieben Meter tiefen mit kleinkörnigem Kies gefüllten Graben sickert das Wasser hindurch und wird kaum hundert Meter weiter wieder über einen Brunnen aus dem Boden herausgeholt. Noch befindet sich das ganze Konzept im Versuchsstadium. Sollten sich die Erwartungen an das Projekt bewahrheiten, könnte über die erforschte Technik Wasser effektiv gereinigt werden, um Grundwasserstände und Wasserversorgung auch in trockenen Zeiten stabil zu halten. Am Mittwoch stellten die Berliner Wasserbetriebe ihre Versuchsanlage auf dem Standort des ehemaligen Wasserwerks Johannisthal vor.
»Die Ergebnisse von den Messstellen zeigen, dass wir so Trinkwasser fördern können«, sagte Wasserbetriebe-Forschungschefin Regina Gnirß. Denn auf dem Weg des zuvor belüfteten, also mit Sauerstoff angereicherten Wassers vom Sickerschlitz bis in den Brunnen würden Mikroorganismen Spurenstoffe abbauen, die den Sauerstoff brauchen. Zuvor muss allerdings in einer Aufbereitungsanlage noch Eisen und Mangan aus dem Wasser entfernt werden, um den Kiesfilter im Versickerungsgraben nicht zu verstopfen. »Wir untersuchen, ob wir so die Qualitätsstandards einhalten können«, so Gnirß.
Auf dem Gelände des 1901 in Betrieb genommenen Wasserwerks in Johannisthal wird seit 2001 kein Trinkwasser mehr gefördert – der Boden wurde als zu sehr mit Schadstoffen belastet eingestuft und der Wasserbedarf war rückläufig. Inzwischen allerdings gibt es durchaus wieder Bedarf an weiteren Wasserwerken zur Trinkwassergewinnung. Deswegen werden Reaktivierungen von stillgelegten Werken wie in Johannisthal geplant.
Zu erproben, wie Wasser durch Sickerschlitze gereinigt wird, dient auch dem Ziel, Optionen für eine erneute Trinkwassergewinnung an diesem Standort zu finden. Perspektivisch könne das am Ufer des Teltowkanals geförderte und durch die Sickerschlitze gereinigte Wasser als Rohwasser in ein Wasserwerk zur weiteren Trinkwasseraufbereitung geleitet werden, heißt es von den Wasserbetrieben.
»Es ist wichtig, dass wir unser Wasser hier wiederaufbereiten. Wir kennen unser Wasser am besten.«
Regina Gnirß Berliner Wasserbetriebe
Doch solche Versickerungsanlagen könnten in Zukunft nicht nur der Säuberung des Wassers zur Trinkwassergewinnung dienen, sondern auch das Grundwasser anreichern. »Das ist ja hier nur eine Pilotanlage. Das kann man viel größer denken und in Zukunft auch anderes Wasser, zum Beispiel Regenwasser, dort hereingeben und damit den Grundwasserstand stabilisieren«, sagte Gesche Grützmacher, Chefin der Wasserversorgung bei den Wasserbetrieben, in Johannisthal. Denn nach aktuellen Prognosen werden auch in den kommenden Jahren Dürreperioden und Starkregen zunehmen. Deshalb ist es wichtig, Regenwasser gezielt aufzufangen und einzusetzen. »Wir müssen Speichermöglichkeiten schaffen«, sagte Grützmacher. Im Konzept der Schwammstadt sei die Regenwassernutzung schon lokal und im Kleinen enthalten, mit solchen Versickerungsanlagen könnte man aber im Großen Regenwasser ins Grundwasser versickern lassen.
Schon jetzt betreiben die Wasserbetriebe an anderen Standorten Versickerungsbecken, die eine ähnliche Funktion erfüllen. Doch die brauchen viel mehr Platz als der einen Meter breite Graben. Wolle man etwa in austrocknenden Wäldern den Grundwasserstand heben, dann könnte mit Versickerungsschlitzen gearbeitet werden, ohne dass zu viele Bäume gefällt werden müssten, sagte Grützmacher. Außerdem verdunste in den großen Becken ein erheblicher Teil des Wassers – in den abgedeckten Versickerungsgräben hingegen nicht.
Um dem Wassermangel in der Region gegenzusteuern, setzen die Wasserbetriebe darauf, den Berliner Wasserkreislauf zu optimieren. »Es ist ein Nachhaltigkeitsthema, das Wasser, das wir brauchen, vor Ort zu entnehmen«, sagte Gnirß. Das sei besser, als das Wasser von woanders zu holen. Aktuelle Vorschläge in dieser Richtung von anderen Akteur*innen sind etwa eine Überleitung von Wasser aus Oder, Elbe oder Neiße und eine Entsalzung von Ostsee-Wasser. »Es ist wichtig, dass wir unser Wasser hier wiederaufbereiten. Wir kennen unser Wasser am besten«, so Gnirß. Bedingt ist der Wassermangel durch die Klimakrise und durch den geplanten Kohleausstieg, der dazu führt, dass die Spree in Berlin weniger Wasser führen wird.
Das Interesse an dem Einsatz von Versickerungsschlitzen beschränkt sich derweil keineswegs auf Berlin. An dem Projekt zur Prüfung der Wasserwiederverwendung in urbanen Wasserkreisläufen beteiligt sich auch das Bundesforschungsministerium und Universitäten in München und Oldenburg. Die ersten Ergebnisse aus der Versuchsanlage bewerten die Wasserbetriebe positiv. Bis Ende dieses Jahres soll ein Abschlussbericht zur finalen Auswertung vorliegen, sagte Wasserversorgungs-Chefin Grützmacher.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.