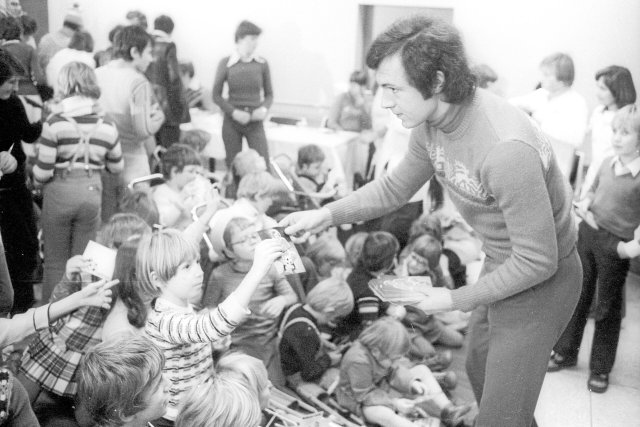- Kultur
- Die gute Kolumne
Im Würgegriff der Sprachbildschlange
Der Journalist und der Lyriker haben Vieles gemein. Unter anderem das Gespür für barocke Sinnbilder

Was mich stets beeindruckt hat, ist die enge Verwandtschaft der Tätigkeit eines Auslandskorrespondenten mit der eines bedeutenden Schriftstellers der Moderne: Beide produzieren hauptberuflich Text, beide nehmen für sich in Anspruch, unsere gegenwärtige Realität abzubilden, und beide pflegen nicht selten einen radikal experimentellen Umgang mit der Sprache.
Nehmen wir zum Beispiel einen typischen Auslandskorrespondentensatz wie diesen: »Die Hybris der Staatsführung scheint langfristig ein stumpfes Schwert zu werden.« Der kühne journalistische Stil, bildersatt und saftig, wie man das von politischen Kommentatoren kennt, ist so kunstvoll, ja, feinsinnig gedrechselt, dass er auf den Leser wirkt wie reine Poesie.
Könnte der Satz nicht auch dem neuesten Gedicht von Durs Grünbein entstammen? Man müsste ihn nur etwas entschlacken, künstlich antikisieren und in Versen schreiben: »Die Hybris des Staatenlenkers / Eher später als früher / Wird sie zum stumpfen Schwert.« Und schon hat man im Handumdrehen mit ein bisschen Fingerspitzengefühl aus einem Satz, der wahllos irgendeinem politischen Zeitungskommentar entnommen wurde, drei Gedichtzeilen für die Ewigkeit gezaubert. Verblüffenderweise funktioniert das Verfahren in gewisser Weise auch andersherum, das heißt: Man kann sich auch zweier Verse aus einem Gedicht (»Kosmopolit«) von Grünbein bedienen und findet darin eine der zentralen Grunderfahrungen des Auslandskorrespondenten wieder: »Von meiner weitesten Reise zurück, anderntags / Wird mir klar, ich verstehe vom Reisen nichts.«
Doch lassen wir das. Wenden wir uns wieder der Kunst des Auslandskorrespondenten zu, seinem virtuosen Umgang mit originellen Sprachbildern und pfiffigen Metaphern. Kürzlich las ich etwa: »Im Windschatten des Krieges, durch den die Karten neu gemischt wurden, zog die Regierung die Notbremse.« Auch hier ein lebenspralles Bild, das keine Leserwünsche offenlässt: Der Krieg – wir sehen ihn, das Monstrum, böse, waffenstarrend und blutdürstig, dasitzen, wie er mit Kartenmischen beschäftigt ist, während in seinem Schatten, auf dem Fußboden, die Mitglieder des Regierungskabinetts, zusammengezwängt in einem Fahrzeug, mit hoher Geschwindigkeit permanent im Kreis um ihn herumfahren müssen, bis es schließlich dem beherzten Regierungsoberhaupt gelingt, durch einen Griff nach der Notbremse den Spuk zu beenden. Was sich bei oberflächlicher Lektüre liest wie eine turbulente Szene aus einem wahnwitzigen Fantasy-Epos, ist tatsächlich: Journalismus vom Feinsten.
Sieht man genau hin, entdeckt man weitere erstaunliche thematische und stilistische Überschneidungen zwischen der großen Literatur und dem bescheidenen Journalismus. Recht häufig etwa liest man in politischen Kommentaren vom Phänomen des Windes, der nahezu in Permanenz durch die Gazetten weht, sodass man sich beim Lesen des jeweils neuesten Nahost-Kommentars stets wie auf einer Schiffsexpedition in die Antarktis wähnt: Wahlweise hat jemand »Rückenwind« oder bekommt »Gegenwind«. Oder ihm wird »der Wind aus den Segeln genommen«. Oder er entfacht einen »Sturm im Wasserglas«, der die »Wellen hochschlagen« lässt. Der Wind als unsichtbare, unberechenbare und unbändige Kraft, die das Schicksal ganzer Weltregionen verändern kann! Als Symbol der Freiheit und der Erneuerung, aber auch der Gefahr und des fortwährenden Hin und Her und Widerstreits! Ja, so entstehen, sozusagen in Windeseile, denkwürdige Leitartikel und Seite-1-Kommentare, die im Kopf der Leser für frischen Wind sorgen. Aber: Ist mithilfe dieser kleinen Wind-Metapher nicht auch Weltliteratur entstanden? Shakespeares Drama »Der Sturm«! Margaret Mitchells Liebesromanklassiker »Vom Winde verweht«! Kenneth Grahames »Der Wind in den Weiden«, einer der besten britischen Romane des 20. Jahrhunderts!
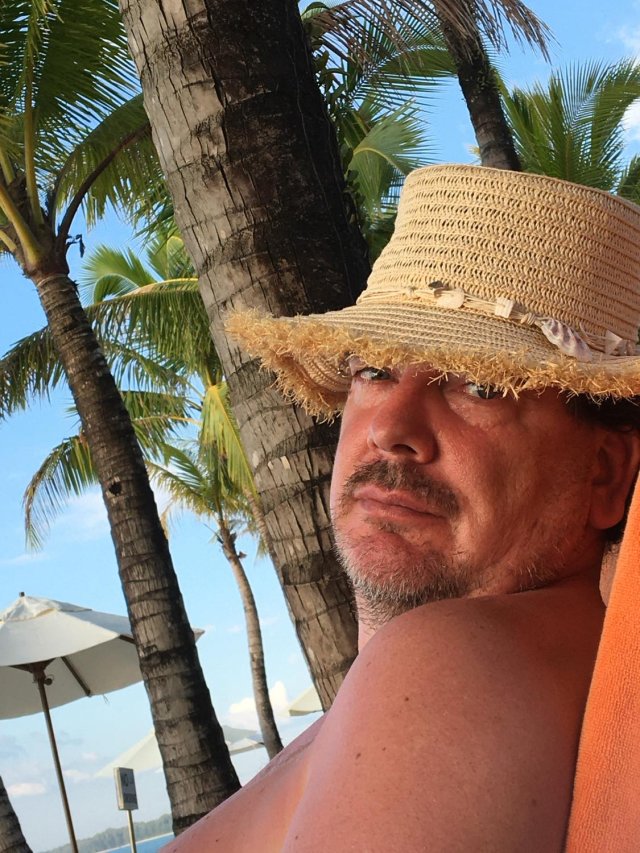
Thomas Blum ist grundsätzlich nicht einverstanden mit der herrschenden sogenannten Realität. Vorerst wird er sie nicht ändern können, aber er kann sie zurechtweisen, sie ermahnen oder ihr, wenn es nötig wird, auch mal eins überziehen. Damit das Schlechte den Rückzug antritt. Wir sind mit seinem Kampf gegen die Realität solidarisch. Daher erscheint fortan montags an dieser Stelle »Die gute Kolumne«. Nur die beste Qualität für die besten Leser*innen! Die gesammelten Texte sind zu finden unter: dasnd.de/diegute
Und geht es am Ende in Zeitungskommentaren und politischen Analysen nicht ebenso aufregend zu wie in der großen Kriegsliteratur des 20. Jahrhunderts? Da werden »Lunten gelegt« und »entzündet«, »Gräben zugeschüttet« und »Abkommen torpediert«; jemand bekommt für sein politisches Handeln eine »schallende Ohrfeige«, oder er wird »ins Visier genommen« oder »an den Pranger gestellt«; es werden »rote Linien überschritten«; eine Situation ist »explosiv«, gerade dann, wenn die Weltregion, um die es geht, ein »Pulverfass« ist. Und manchmal gelingen jemandem »strategische Schläge«, bis einem anderem das »politische Genick gebrochen« wird. Kurz: Man kommt sich beim Zeitungslesen vor, als sei man plötzlich mitten in Ernst Jüngers »In Stahlgewittern«! Zuweilen wird gar mit »stumpfen« (siehe oben) oder »zweischneidigen Schwertern« hantiert, dann ist man nicht bei Jünger, sondern bei Alexandre Dumas (»Die drei Musketiere«) gelandet.
Ich bin mir nicht sicher, ob in einer besseren Zukunft nicht einfach sämtliche Weltliteratur durch Zeitungskommentare politischer Korrespondenten ersetzt werden sollte.
Hmm. Wie gesagt: ich bin mir nicht sicher. Ob das tatsächlich eine so gute Idee wäre, »bleibt vorerst abzuwarten« (um es in der Sprache der Korrespondenten zu sagen).
Sicher ist jedenfalls: Zur großen Kunst des Auslandskorrespondenten und politischen Kommentarschreibers gehört auch der feinfühlige Wechsel zwischen Weltliteratur und Straßenverkehrsatlas (»Sackgasse«, »Kurskorrektur«, »das politische Tandem«, »Fahrplan«, »grünes Licht«, »hat Fahrt aufgenommen« usw.).
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.