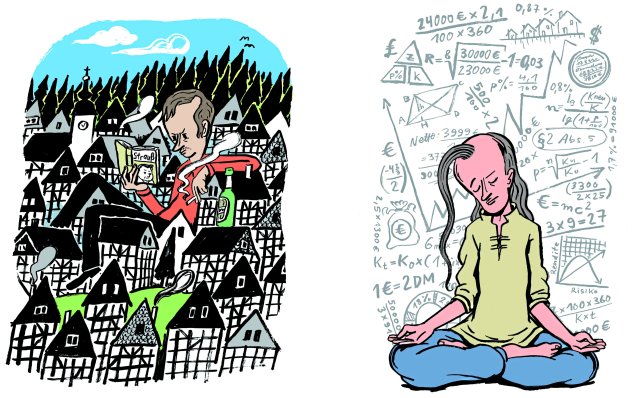- Kultur
- 35 Jahre Einheit
»Danke, Herr Kohl!«
»Der große Schock«: Treuhand-Geschädigte berichteten Katrin Rohnstock und Team über ihre Erfahrungen

»Wir hatten das beste Salz in ganz Deutschland und wurden doch abgewickelt«, beklagt Bernd Schmelzer. Er hat im Kalibergwerk Bischofferode gearbeitet, das zum Synonym des ostdeutschen Treuhand-Traumas geworden ist, aber auch zum Symbol für ostdeutschen Widerstand gegen Entwürdigung, Enteignung, Entrechtung. Der Saal im Domizil der Schreibwerkstatt Rohnstock-Biografien in Berlin-Pankow ist bis auf den letzten Platz besetzt, das Interesse groß – am Zuhören und Mitreden.
Die Literatur- und Sprachwissenschaftlerin Katrin Rohnstock, 1960 in Jena geboren, stellt das neueste von ihr herausgegebene Buch vor: »Der große Schock«. Sie preist es als ein Novum in der mittlerweile reichhaltigen Literatur über die Treuhand, denn hier kommen die Betroffenen zu Wort. Präsentiert wird keine nüchterne soziologische Analyse der großen Katastrophe nach 1990 in Ostdeutschland, sondern Erlebnisse, Erfahrungen, Enttäuschungen, Emotionen, ehrliche, erschütternde, eindrucksvolle. Entsprungen ist diese Bündelung von insgesamt 30 exemplarischen Lebensgeschichten-Erzählsalons, zu denen Katrin Rohnstock und ihr Team 2023/24 in Thüringen einluden. Das kollektive Erinnern war sehr ergiebig.
Vom einfachen Arbeiter bis zum Produktionsleiter ehemals Volkseigener Betriebe (VEB) mit 500 bis zu 2000 Beschäftigten legen hier Zeugnis ab von dem, was ihnen nach der deutschen Vereinigung geschah, angetan wurde. Ihre Schicksale stehen stellvertretend für vier Millionen Arbeitslose in Ostdeutschland Anfang der 90er Jahre. Den Ausverkauf und die Abwicklung ihrer Betriebe, mit denen sie sich identifiziert hatten, erlebten sie als Tragödie. Nicht nur, dass das Arbeitskollektiv, Gemeinschaft und Gemeinsinn von heut’ auf morgen verschwanden, Arbeitslosigkeit, Existenzangst oder gar Obdachlosigkeit waren in der DDR unbekannt und kamen nun über sie wie böse Gespenster. Arbeit hatte ihnen mehr bedeutet als die Sicherung des Lebensunterhalts. Zu diesem empfindlichen Verlust gesellte sich die Verwunderung, dass die herbeigesehnte Demokratie sich als Lug und Trug erwies. Von Mitbestimmung keine Rede. Ihr Schicksal wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Dagegen regte sich alsbald Protest. Dafür war man schließlich nicht im Herbst ’89 in der DDR auf die Straße gegangen. So hatte man sich das nicht vorgestellt, als man für die Vereinigung votierte.
»Hunderte Arbeitsplätze wurden abgebaut, eine Abteilung nach der anderen ausgegliedert«, erinnert sich Bernd Schmelzer. »Unser Werk ›Thomas Müntzer‹ wurde skelettiert. Kulturhaus und Tischlerei, die Betriebsambulanz samt Allgemeinmediziner und Zahnarzt, die mechanischen Werkstätten und die Transportabteilung, die neu errichtete Konsumgüterproduktion, die Werksküche, Schusterei und Näherei sowie der Friseursalon wurden geschlossen.« Das war der Anfang. »Der Betrieb wurde sukzessive heruntergefahren. Dass wir das modernste und rentabelste Kaliwerk auf dem Boden der DDR waren und unsere Grube noch für 40 Jahre gutes Salz bereithielt, spielte keine Rolle. Ende 1992 schloss die Betriebsambulanz, in der meine Frau arbeitete.« Geschmacks- und anstandsloser geht’s wohl nimmer: Zu Weihnachten, am 24. Dezember 1992, fand sie im Briefkasten ihre Kündigung. Noch am selben Tag erhielten auch der Vater und die Mutter von Schmelzer ihre Entlassungsschreiben.
Auch für Bernd Schmelzer schlägt alsbald die bittere Stunde: »›Der Betrieb ist unrentabel‹, wurde uns eingeredet. Die endgültige Werksschließung wurde zum Jahresende 1993 anberaumt.« Da hatte die »Un-Treuhand«, wie die Anstalt unter der Ägide der Hannoveranerin Birgit Breuel auf Demonstrationen und Kundgebungen in Ostdeutschland betitelt wurde, nicht mit dem Stolz der Kumpel gerechnet. Die Belegschaft trat in einen Hungerstreik, der bundesweit, sogar weltweit Aufsehen erregte. Als die ersten Kollegen kollabierten und in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, zumeist nach spätestens zwei Wochen, gehörte Bernd Schmelzer zu denen, die eine Lücke schlossen. »Ich hatte eine Zahnbürste und einen Kamm dabei, mehr brauchte ich nicht. Auf der Pritsche neben mir war ein Skelett mit Bergarbeiterhelm drapiert worden, darüber die Aufschrift ›Danke, Herr Kohl!‹«
14 Tage hielt er durch. Presse, Rundfunk und Fernsehen waren vor Ort. Prominente Künstler, Schriftsteller und Sportler kamen, darunter Stefan Heym und Ruth Fuchs, die DDR-Olympiasiegerin im Speerwerfen. Die Puhdys gaben ein Solidaritätskonzert. Körbeweise erreichte die Streikenden Post, auch Geld- und Sachspenden. Mit besonderer Dankbarkeit erinnert sich Schmelzer an Bodo Ramelow, damals noch einfacher Gewerkschaftssekretär, der den Kumpels beistand, sie auch in rechtlichen Fragen beriet, obwohl ihm dies seine Gewerkschaft verboten hatte. Tja, auch dies gehört zur Wahrheit: Die großen westdeutschen Gewerkschaften haben sich feige, unsolidarisch, hinterhältig verhalten, die ostdeutschen Arbeiter und Angestellten gnadenlos im Stich gelassen. Und hatten alsbald auch die Quittung dafür zu zahlen.
Doch zurück nach Bischofferode und zu Bernd Schmelzer: »Der Schacht wurde geschlossen. Gutes Salz für Jahrzehnte war noch da, aber aus politischen Gründen wurde gegen Bischofferode entschieden. Es ging klar um die Profite anderer. Es lief haargenau so, wie wir es im Staatsbürgerkundeunterricht gelernt hatten … Ende 1993 unterzeichneten wir den ausgehandelten Aufhebungsvertrag. Mit einer Weigerung hätte man seine Abfindung verspielt. Jeder von uns erhielt 7000 D-Mark.« Billig abgespeist. »Wir Bischofferöder landeten gemeinschaftlich in einer sogenannten Beschäftigungsgesellschaft. Bildungsträger und ähnliche Gesellschaften erkannten ihre Chance und fingen auf Teufel komm raus an, Umschulungen zu vermitteln. Tischler wurden zu Bäckern, Bäcker zu Fleischern und Fleischer zu Elektrikern umgeschult; die Ausbildung war reiner Selbstzweck, ohne dass konkrete Arbeitsplätze dranhingen.« Beschäftigungstherapie, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) verkauft. Ein Gewerbepark mit Anschlussarbeitsplätzen war versprochen worden, erinnert sich Schmelzer bei der Buchpremiere in Pankow. Diesen gibt es bis heute nicht. »Vertraut uns«, hätten die Politiker seinerzeit die Kumpels gebeten. »Dieses Vertrauen habe ich damals verloren und bis heute nicht wiedergefunden.«
Ähnlich die Erinnerungen ehemaliger, vornehmlich weiblicher Beschäftigter der Esda-Strumpffabrik in Diedorf, des Henneberger Porzellanwerkes sowie des Möbelwerks in Eisenberg und des VEB Relaistechnik in Großbreitenbach. Auch hier waren 90 Prozent der Beschäftigten Frauen, darunter Petra Enders, ab 1999 Bürgermeisterin in Großbreitenbach. Das Schlimmste, bestätigt sie, sei das Gefühl gewesen, nicht mehr gebraucht zu werden. »Aufgeben wollten wir trotzdem nicht«, sind die Erinnerungen von Regina Rißland überschrieben, die um den Erhalt des Betriebskindergartens der Relaistechnik kämpfte.
Lebhaft die Diskussion zur Buchpremiere, den zeitlichen Rahmen einer solchen weit überschreitend. Ein Redakteur des »Bauernechos«, der Tageszeitung der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD) mit dereinst 225 000 verkauften Exemplaren, berichtet von der Übernahme und Abwicklung durch einen westdeutschen Medienkonzern, eine leitende Angestellte des VEB Ingenieurhochbau Berlin, »eines der reichsten Unternehmen des Landes, mit exzellenten Baumeistern, Bauzeichnern, Projektleitern und vollen Auftragsbüchern«, über dessen Verscherbelung für ’nen Appel und ’n Ei an einen österreichischen Kleinunternehmer, »der simple Einfamilienhäuser baute« – und sich natürlich übernahm, Insolvenz anmelden musste. Spannend auch der kleine Disput zwischen einem Vertreter der Staatlichen Plankommission der DDR und einer Lebensmitteltechnologin. Er: »Die DDR-Wirtschaft war nicht marode. Wir haben alle unsere Schulden im Ausland bezahlt.« Sie: »Aber warum mussten wir für teure Devisen Rosinen importieren?«

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Einen regelrechten Politthriller steuerte Lukas Stoll bei, der die Treuhand-Akten zum Relaiskombinat studierte. Nach Aufhebung der 30-jährien Sperrfrist hat der junge Mann aus Frankfurt am Main, Jahrgang 1991, über 10 000 Blatt im Berliner Bundesarchiv gesichtet, um zu eruieren: Haben westdeutsche Investoren das Unternehmen mithilfe der Treuhand vom Markt gedrängt? Oder scheiterte die Firma an sich selbst? Wen wundert’s: Die Bayern waren’s, betrieben ein teuflisches Spiel. Hauptinteressent an der Ausschaltung der Konkurrenz im Osten war die Schaltbau AG München. Das Fazit des Juristen: »Ein ernsthafter Versuch der Treuhandanstalt, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens herzustellen, ist zu keinem Zeitpunkt erkennbar. Der westdeutsche Wettbewerber der gleichen Branche hatte kein Interesse daran, seine eigene Konkurrenz aufzubauen. Dass dieser im Kapitalismus nur natürlich Umstand von der damaligen Politik nicht gesehen wurde, ist inhaltlich nicht nachvollziehbar und im Ergebnis tragisch.«
Ein Buch, das man lesen sollte. Und das bestätigt, was der Redakteur des »Bauernechos« bei der Buchpremiere meinte: »Die Treuhand war nur der Hund an der Leine, den man hätte zurückpfeifen können, wenn man es gewollt hätte.« Doch dies war von der Politik nicht gewollt.
Apropos: Rohnstock und ihr Team hatten auch maßgeblichen Anteil an der seit 2019 erfolgreich durch Deutschland tourenden Wanderausstellung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Treuhand.
Katrin Rohnstock (Hg.): Der große Schock. Ostdeutsche erzählen von den Folgen der Treuhandpolitik. Bebra-Verlag, 240 S., br., 22 €.
Nächste Lesung: diesen Mittwoch, 24.9., 18 Uhr, Freizeithaus Weißensee, Pistoriusstraße 23, Berlin.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.