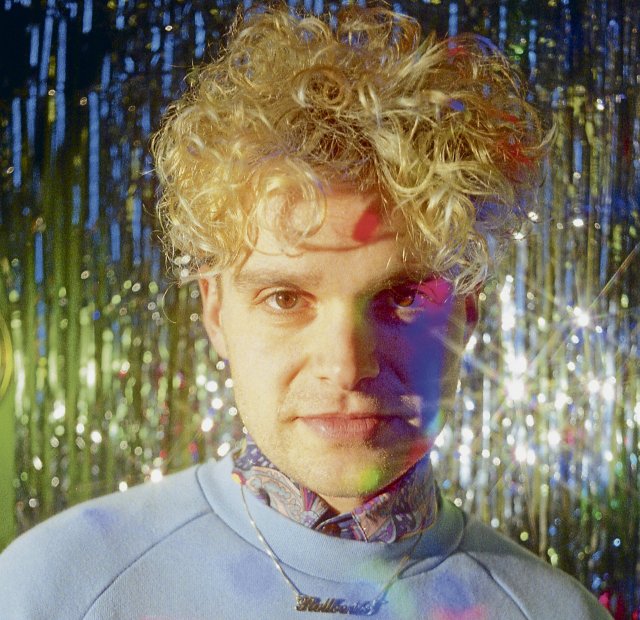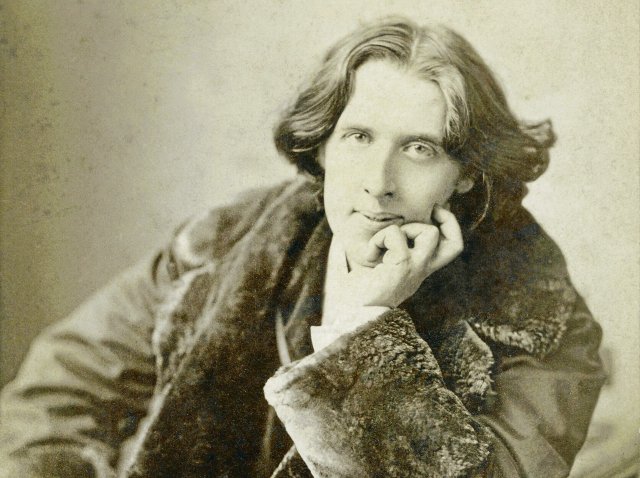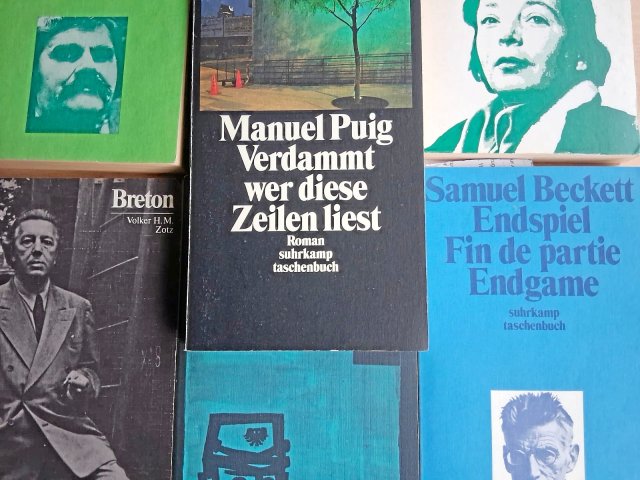- Kultur
- London Filmfest 2025
Von London nach Manila
Das London-Filmfest geht an diesem Wochenende zu Ende. Eine Begegnung

Filmfestivals dürfen nicht in den reizvollen Städten stattfinden. Wenn das, was da draußen passiert, interessanter ist als das auf der Leinwand, ist das Kino schon verloren. London ist solch eine Stadt. Wenn das Wetter auch mitmacht, möchte man überhaupt nicht ins Kino gehen. Und das hat nicht einmal mit der Qualität des London-Filmfestivals oder der Filme zu tun. Kein Film kann mit dieser pulsierenden, mysteriösen, vielfältigen Stadt mithalten. Und ja, Diversität zeigt sich in jedem Aspekt der Stadt – sorry, Berlin, du bist nur ein Fake-Bild von Multikulti, auch kulinarisch gesehen.
Die Menschen wirken nicht unglaublich enthusiastisch oder überfreundlich, aber auch nicht unbedingt verbittert und rotzig wie in Berlin. Sie sind meist höflich und hilfsbereit. Man hat den Eindruck, dass die Stadt mit allem drin alles tut, dass man klarkommt. In den öffentlichen Verkehrsmitteln etwa, auf die man sich verlassen kann – Wahnsinn! –, wird ständig mit Text und Ton über die Linien und die Namen der aktuellen Stationen informiert. Wegen des Linksverkehrs steht an den Kreuzungen direkt auf dem Asphalt, in welche Richtung man schauen soll. Und interessanter als rote Telefonzellen oder Doppelstockbusse ist – für jemanden, der aus Berlin kommt –, dass man buchstäblich überall bargeldlos zahlen kann.
Während die Stadt von unzähligen Theaterhäusern und Musicals wimmelt, wirken die Kinos in London hingegen unscheinbar. Um dem Filmfestival eine Dosis Pomp zu verleihen, finden zumindest die Galas in der Royal Festival Hall statt (hier ist alles royal, sogar das China-Restaurant um die Ecke heißt »Royal China«). Die große Halle mit einem kurvenförmigen Auditorium mit 2700 Sitzplätzen im Stadtteil Southbank Centre am Südufer der Themse, die sonst vor allem der Konzertsaal des London Philharmonic Orchestra ist, sollte während des Filmfestivals Promis und Publikum auf sich ziehen.
Viele Celebritys, die entweder im Frühling in Cannes oder im Sommer auf dem Venedig-Filmfestival waren, werden im Herbst in London gesichtet. Dieselben Gesichter auf unterschiedlichen Red Carpets. Man kann sich kaum ein Filmfestival vorstellen, auf dem etwa Tilda Swinton nicht anwesend ist – sogar auf der Pariser Fashion Week sieht man sie!
Dabei ist das Londoner Filmfest, das vom 8. bis 19. Oktober stattfindet, in erster Linie ein Publikumsfestival. Die Karten werden erst für das Publikum zugänglich gemacht und viel später für die Presse und Industrie. Als Journalist*in an den Abendvorführungen teilzunehmen, ist hier schwieriger als in Cannes.
Neben den Gala-Filmen, die auf einem anderen renommierten Festival ihre Premiere feierten, hat das London-Filmfest vier Wettbewerbe mit jeweils zehn Titeln, darunter einen für die Dokumentar- und einen für die Debütfilme. Einige der originellen und erfrischenden Geschichten des Festivals kann man eben bei den Erstlingsfilmen finden.
Hier ist alles royal, sogar das China-Restaurant um die Ecke heißt »Royal China«.
»Songs of Forgotten Trees«, der Debütfilm der indischen Regisseurin Anuparna Roy, handelt von zwei jungen Frauen, die sich eine Wohnung in Mumbai teilen; die eine versucht, Schauspielerin zu werden, empfängt abends aber in ihrem Zimmer als Escort Männer. Die andere arbeitet in einem Call-Center. Irgendwann entsteht eine zarte Intimität zwischen den beiden Frauen.
In einem Gespräch mit »nd« sagt Roy, dass der Film von ihrer eigenen Familiengeschichte inspiriert ist. Ihre Großmutter musste mit neun Jahren einen 30-jährigen Mann heiraten, der schon eine neunjährige Tochter hatte. So werden die Kinderbraut und ihre Stieftochter eher zu Freundinnen als Mutter und Tochter. Die Braut bekommt vier Töchter, und nachdem der Mann gestorben ist, ziehen die zwei Frauen, also die Braut und ihre Stieftochter, die vier Kinder zu zweit groß und führen die Familie ohne irgendeinen Mann weiter. »Das hat mich fasziniert, dass es dort keinen Männerbedarf gab«, so Roy. Die Freundschaft zwischen ihrer Großmutter und deren Stieftochter brachte Roy dazu, sich weiter vorzustellen, warum sich diese zwei Frauen nicht ineinander verlieben können. So wollte sie eine Geschichte über zwei Frauen und deren Intimität erzählen.
Den Film hat sie interessanterweise komplett in ihrer eigenen Wohnung in Mumbai gedreht, sie hat sogar die zwei Laienschauspielerinnen eingeladen, zeitweise dort mit ihr zu leben. Sex-Arbeit sei in Indien ein Tabu-Thema, wie Roy meint, doch sie wollte immer eine Sex-Arbeiterin porträtieren, die sich nicht entschuldigt für die Tatsache, dass sie eine Sex-Arbeiterin ist. »Eine, die versucht, in der Stadt smart zu handeln, Männer zu verarschen, ohne es zu bereuen, diese zum Narren zu halten. Einfach eine ›unapologetic woman‹ (eine Frau ohne Reue)«, so Roy.
Eine andere Frau, die ebenfalls keine Notwendigkeit sieht, sich ständig für ihr Dasein oder ihren Lebensstil zu rechtfertigen, porträtiert die kenianische Filmemacherin Vincho Nchogu ebenfalls in ihrem Debütfilm »One Woman One Bra«. Erzählt wird darin die Geschichte von Star, einer 38-jährigen, verwaisten, unverheirateten und kinderlosen Massai-Frau, die alleine in einem Dorf an der kenianischen Grenze zu Tansania lebt. Als andere Dorfbewohner*innen endlich ihre Eigentumsurkunden erhalten und damit zum ersten Mal den rechtlichen Besitz ihres Landes beanspruchen können, bekommt Star keine. Die Urkunden basieren auf Verwandtschaftsbeziehungen, und da ihre Abstammung unbekannt und sie unverheiratet ist, ist sie kurz davor, ihr Land zu verlieren. Ihr bleiben wenige Möglichkeiten: ihre Eltern und damit ihre Geburtsurkunde zu finden, zu heiraten oder irgendwie ans Geld zu kommen, um selbst ihr Land kaufen zu können.

In der Hoffnung, dass sie und andere Frauen ihrer Community finanzielle Unterstützung bekommen, macht sie einen Deal mit einer NGO, um ein Werbevideo mit dem titelgebenden Slogan »Eine Frau, ein BH« über die Massai-Frauen zu drehen. Auf dem Video sehen wir eine junge Massai-Frau, die schwere Sachen wie Holz, Wasser- oder Milchbehälter trägt und dabei sagt, sie trage Gewicht, sie trage die Last des Frauseins: »Jeden Tag trage ich die Last meiner Brüste, nehmen Sie diese Last von meinen Schultern und geben Sie mir einen BH!«
»Die Szene ist eine Anspielung auf meine eigenen Tage bei den NGOs«, sagt die Regisseurin zu »nd«. Sie hat früher für eine Produktionsfirma gearbeitet, die NGO-Filme machte. Aus ethischen Gründen hat sie irgendwann den Job gekündigt. »Manchmal bieten die NGOs, die eigentlich eine gute Absicht haben, die falsche Lösung an«, so Nchogu. Bei den NGOs gehe es oft um die Auswirkung. Und bei der Auswirkungsfrage sei man gezwungen, Zahlen anzugeben. »Mit der BH-Lösung kann man etwa die Zahlen zählen und sagen: ›Wir haben jenem Dorf 700 BHs gegeben.‹«
Am Ende bekommen die Massai-Frauen im Film natürlich kein Geld von der NGO, sondern viele BHs!
Nchogu, die von Nairobi nach New York gegangen ist, um an der Columbia University Film zu studieren, meint, dass die Pioniere der kenianischen Filmindustrie Frauen seien. »Da das Filmemachen nicht ernst genommen wurde und weil Männer ›männliche‹ Berufe ausüben wollten, wurden die Frauen zu Schöpferinnen, zu Geschichtenerzählerinnen.«
Die Hauptfigur Star in »One Woman One Bra« und ihre Art zu leben entsprechen nicht den Klischees, die man normalerweise in den Filmen über Afrika zu sehen bekommt. Warum gibt es in den Geschichten, die in afrikanischen Ländern spielen, nicht mehr von solchen Frauen? »Viele von uns afrikanischen Filmemacher*innen haben in der westlichen Welt studiert, manchmal kann man sich verlieren, vergessen, wo man herkommt«, reflektiert Nchogu über die möglichen Gründe. Dazu kommt noch die Frage der Filmförderung. »Das afrikanische Kino ist stark beeinflusst durch westliche Finanzierung«, erklärt Nchogu. »Die Filme, die eher eine Finanzierung bekommen, sind oft die, die afrikanische Probleme oder Armut zeigen, sind themenbezogene Filme. Das ist nicht meine Geschichte, das ist nicht mal die Geschichte vieler afrikanischer Länder; etliche dieser Länder sind stabil, Menschen leben ihr Leben normal. Ich sage nicht, dass Menschen in Afrika keine Probleme haben, aber die Probleme und Kämpfe werden überrepräsentiert, das normale Leben eben nicht.«
Eine weitere bewegende Geschichte erzählt die junge Regisseurin Janus Victoria aus den Philippinen in ihrem Spielfilmdebüt »Diamonds in the Sand«. Der Film, der eine japanisch-philippinisch-malaysische Koproduktion ist und dessen Realisierung etwa elf Jahre gedauert hat, thematisiert den japanischen Begriff Kodokushi, den einsamen Tod. Yoji, ein geschiedener Büroarbeiter, lebt ein isoliertes Leben in Tokio. Als sein Nachbar tot in seiner Wohnung gefunden wird und eine Dienstleistung für die Reinigung des verwesten Körpers und die Auflösung seiner Wohnung kommt, kann Yoji kaum wegschauen. Die Dienstleister erzählen ihm, dass gerade im Frühling deren Business boomt.
Daraufhin versucht Yoji, seine Mutter, die von einer philippinischen Krankenschwester namens Minerva im Altersheim gepflegt wird, öfter zu besuchen. Eben von den philippinischen Pflegerinnen, die immer zu Mittag zusammen essen, bekommt er mit, dass man in den Philippinen niemals allein sei, auch nicht, wenn man es wolle. Nach dem Tod seiner Mutter folgt Yoji Minerva nach Manila. Dort angekommen, wirkt der Japaner sehr deutsch! In der ersten Nacht beschwert er sich über die nicht eingehaltene Ruhezeit. Allmählich lernt er eine andere Art des Gemeinschaftslebens kennen, die überwältigend, schön und störend zugleich ist. Das Leben geschieht eher auf der Gasse als in der Wohnung; die einfachen Tische auf der Gasse, an denen die Nachbarn zu jeder Gelegenheit zusammen essen, sind so einladend, dass man animiert wird, sich als allererstes ein Ticket nach Manila zu buchen. Ist das nicht der Sinn eines Filmfestivals, gleich nach einem Film zu beginnen, weiter zu träumen? Doch die Gassen Manilas haben auch ihre dunklen Geschichten, die die Regisseurin den Zuschauenden nicht vorenthält.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.