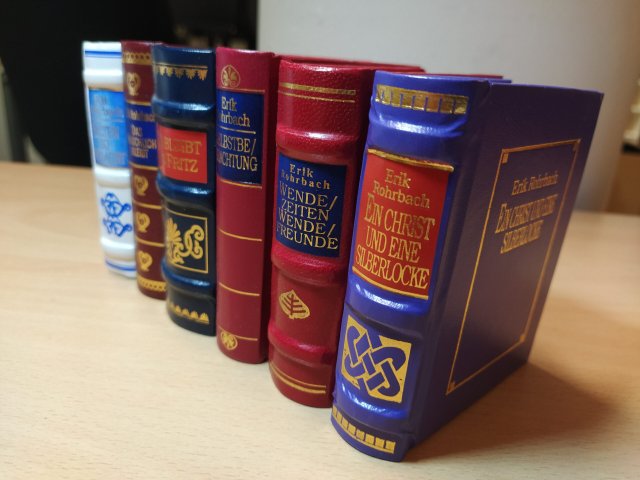- Berlin
- Gesundheitswesen
Zahnarztpraxen wackeln bedenklich
In Brandenburg wird sich der Mangel an Ärzten, Apothekern und Psychotherapeuten noch verschärfen

»Viele Menschen sehen ihren Zahnarzt öfter als ihren Hausarzt«, weiß Romy Ermler, Präsidentin der brandenburgischen Zahnärztekammer. Dadurch hat sich etwas getan. Die Karieslast in der bundesdeutschen Bevölkerung sei seit 1991 um mehr als 90 Prozent gesunken und viele Senioren haben heutzutage noch alle ihre Zähne und nicht bereits relativ früh ein Gebiss.
Doch die Zukunft sieht einigermaßen düster aus. Bis 2030 werden 40 Prozent der derzeit im Land Brandenburg tätigen Zahnärzte in den Ruhestand treten. Rund die Hälfte ihrer Praxen werde voraussichtlich nicht nachbesetzt werden können, berichtet Ermler am Montag. Die Folge: Die zahnärztliche Versorgung für 600 000 Brandenburger wäre nicht mehr gesichert. »Die Politik darf nicht länger zusehen«, sagt Ermler.
In anderen Bereichen des Gesundheitswesens zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Ärztemangel ist allgemein. 400 Stellen für Hausärzte sind jetzt schon unbesetzt, informiert Catrin Steiniger, Vorstandschefin der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Bei den Fachärzten setzt sich das fort. Besonders gesucht sind Haut- und Augenärzte.
Auch die Kliniken haben Probleme, Mediziner anzuwerben. »Ohne die ausländischen Kollegen könnte man zumindest im ländlichen Raum kein Krankenhaus mehr betreiben«, sagt Detlef Troppens, Vorstandschef der Landeskrankenhausgesellschaft. Das scheine auf den ersten Blick unverständlich, da es nicht weniger Absolventen gebe als in früheren Jahrzehnten. Doch die jungen Mediziner wollen heutzutage häufig nur Teilzeit arbeiten.
Auch die Apotheken haben zu kämpfen. 36 Apotheken habe Brandenburg allein in den vergangenen drei Jahren verloren, weil es an Pharmazeuten und pharmazeutisch-technischen Assistenten fehle, beklagt Katrin Wolbring, zweite Vizepräsidentin der Landesapothekerkammer. Seien auf eine Apotheke im Bundesland vor acht Jahren noch 4300 Menschen gekommen, seien es mittlerweile bereits 4900 – und weil sich der Trend fortsetzt, werden Wolbring zufolge in fünf Jahren mehr als 700 000 Brandenburger einen weiteren Weg auf sich nehmen müssen, um ihre Medikamente zu holen.
Gebessert habe sich die Lage bei den Psychotherapeuten, bekennt Dietmar Schröder von der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer. Aber der Bedarf sei schneller gewachsen als das Angebot, vielleicht auch deshalb, weil psychische Erkrankungen inzwischen weniger stigmatisiert seien und sich mehr Menschen trauen, professionelle Hilfe bei einem Psychologen zu suchen. Einen Psychotherapeuten zu finden, der sich um sie kümmern kann, scheint dann aber manchmal schier unmöglich. Dabei könnten seine Kollegen mehr leisten, versichert Schröder. Viele haben jedoch nur einen halben Versorgungsauftrag zuerkannt bekommen, weil der tatsächliche Bedarf von den Krankenkassen nicht anerkannt werde.
Die Ärzte, die Apothekerin und der Psychotherapeut sind am Montag im Raum E 060 des Potsdamer Landtags zusammengekommen, um einmal mehr Alarm zu schlagen. Sie warnen: »Ein funktionierendes Gesundheitssystem ist eine tragende Säule unseres Sozialstaats und damit enorm wichtig für das Vertrauen in die Demokratie.«
Doch das Vertrauen in die Politk schwindet. Die Grundidee »ambulant vor stationär«, die der Krankenhausreform des alten Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) zugrunde liegt, erkennen Detlef Troppens und Catrin Steiniger als richtig an. Aber es dürfe nicht heißen, »ambulant statt stationär«. Wenn die Sozialausgaben schneller steigen als das Bruttoinlandsprodukt, müsse Entbehrliches tatsächlich auf den Prüfstand, gesteht Troppens zu. Doch das Notwendige müsse bleiben. Was das Notwendige sei, »daran scheiden sich die Geister«. Es habe große Hoffnung gegeben, dass die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) die großen Fehler bei der Krankenhausreform noch korrigiert. Es seien aber leider lediglich ein paar kleine Veränderungen vorgenommen worden. Lob hat Troppens für Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD), der sich im Bundesrat gegen den Bundesgesundheitsminister Lauterbach gestellt hatte – jedoch vergeblich. Den Ländern, eigentlich für ihre Krankenhäuser zuständig, sei die Grundlage für die Planung der stationären Versorgung weitgehend entzogen, bedauert Troppens.
Trotzdem erhoffen sich die Mediziner Hilfe von der Landespolitik. Unter den derzeitigen Gegebenheiten würde sich die Gesundheitsversorgung drastisch verschlechtern. Die flächendeckende Versorgung würde massiv gefährdet, heißt es. Die von SPD und BSW gebildete Landesregierung müsse dringend gegensteuern.
Die drei Frauen und zwei Männer formulieren am Montag ihre Forderungen. So wünscht sich Romy Ermler, dass bei der neuen Universitätsklinik in Cottbus auch Zahnärzte ausgebildet werden, was bisher nicht vorgesehen ist. Eine Maßnahme gegen den Ärztemangel wäre auch, Bürokratie abzubauen, die pro Woche bis zu zehn Stunden Arbeitszeit vergeude, die besser zum Behandeln von Patienten verwendet wären.
Katrin Wolbring weist darauf hin, dass die Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistenten die einzige Ausbildung für einen Gesundheitsberuf sei, bei der die jungen Menschen keine Vergütung nach Art des Lehrlingsgeldes erhalten. Da überlegten sich Schulabgänger genau, ob sie nicht lieber einen anderen Beruf ergreifen wollen. Ausgebildet wird in einer Klasse mit 24 Schülern in Eisenhüttenstadt. Die Ausrüstung der Ausbildungsstätte müsse aus Spenden finanziert werden. Diese Verhältnisse müssten sich ändern, findet Wolter. Erstrebenswert wäre, geeignete Assistenten per Studium in Cottbus oder Senftenberg zu Pharmazeuten weiterzubilden.
Daneben werden auch Dinge verlangt, die nicht bloß Menschen angehen, die sich ihre Brötchen im Gesundheitswesen verdienen. Beispielsweise ein zuverlässiger öffentlicher Personennahverkehr, damit Patienten ohne eigenes Auto zur Sprechstunde gelangen können. Romy Ermler mahnt, nicht bei den Betreuungszeiten in den Kitas zu sparen. Wenn Zahnärzte und Zahnarzthelfer ihre kleinen Kinder früher abholen müssen, schränke das die Zeit ein, in der sie Zahnschmerzen und andere Beschwerden behandeln können.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.