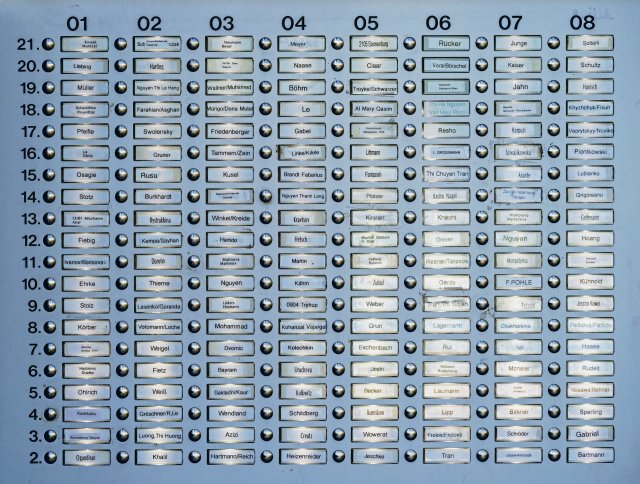- Wirtschaft und Umwelt
- Klimawandel
Gefährliche Hitze am Arbeitsplatz
Der Klimawandel bedroht zunehmend die Gesundheit von Lohnabhängigen

Bereits jetzt sind über 2,4 Milliarden Beschäftigte immer wieder übermäßiger Hitze ausgesetzt. Der Klimawandel verschärft ihre Lage und gefährdet vor allem jene, die in schlecht klimatisierten Räumen oder unter freiem Himmel arbeiten. Eine aktuelle wissenschaftliche Analyse der Weltgesundheitsorganisation (WHO), gemeinsam veröffentlicht mit der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), zeigt, wie steigende Temperaturen weltweit Gesundheit und Arbeitsleistung von Lohnabhängigen beeinträchtigen. Die Autor*innen warnen vor wachsenden Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel: Die Zahl der Schwächeanfälle, Hitzschläge, Nierenschäden und Hautkrebserkrankungen nimmt zu.
Ko Barrett, stellvertretender WMO-Generalsekretär, betont zur Veröffentlichung der Analyse: »Extreme Hitze am Arbeitsplatz ist eine globale Herausforderung, die längst nicht mehr auf Äquatorregionen beschränkt ist – wie die jüngste Hitzewelle in Europa zeigt.« Aktuellen Projektionen zufolge ist aufgrund des Klimawandels im 21. Jahrhundert mit einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von 1,4 bis 3,1 Grad Celsius zu rechnen. Laut WMO war 2024 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Temperaturen stiegen über 40, teils sogar über 50 Grad.
»Manche Arbeitgeber stellen Wasser bereit, aber viele Beschäftigte müssen sich selbst versorgen – trotz Zwölf-Stunden-Schichten.«
Kateryna Danilova Faire Mobilität
Dafür ist der menschliche Körper nicht gemacht, erst recht nicht bei physisch belastender Arbeit. Pro Grad über 20 Grad Celsius sinkt die Arbeitsproduktivität laut Berechnungen der Studienautor*innen um zwei bis drei Prozent. Ohnehin werden nur zwölf bis 18 Prozent der menschlichen Energie in Muskelkraft umgesetzt. Der Rest übersetzt sich in Wärme. Um den Körper zu kühlen, wird Schweiß abgesondert. Zudem weiten sich Blutgefäße, das Herz schlägt schneller, um die Organe zu versorgen. Je heißer es wird, desto stärker kämpft der Körper. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, chronisch Kranke und Personen mit geringer Fitness.
Jeremy Farrar, stellvertretender WHO-Generaldirektor, betont: Der Schutz der Arbeiter*innen vor extremer Hitze sei nicht nur ein gesundheitliches Gebot, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Sinkende Produktivität und eine steigende Zahl von Arbeitsunfällen gefährden die Stabilität von Lebensmittelpreisen und Einkommen. Laut Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation führt Hitzestress, verbunden mit Erschöpfung und Konzentrationsstörungen, bereits jetzt zu mehr als 22,85 Millionen Arbeitsunfällen pro Jahr.
Mehr Pausen sowie klimatisierte Arbeitsplätze und Unterkünfte sind entscheidend. Doch gerade auf dem Bau oder in der Landwirtschaft fehlt es daran. Auch in Deutschland, weiß Kateryna Danilova. Sie arbeitet für Faire Mobilität, ein internationales Beratungsnetzwerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und beobachtet seit Jahren die Bedingungen migrantischer Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft. »Viele Unternehmen stellen nur Metallcontainer bereit, die sich tagsüber aufheizen und kaum Abkühlung bieten«, sagt sie im Gespräch mit »nd«.
Auch Trinkwasser auf den Feldern ist oft knapp. »Manche Arbeitgeber stellen Wasser bereit, aber viele Beschäftigte müssen sich selbst versorgen – trotz Zwölf-Stunden-Schichten.« Zudem halten niedrige Löhne Arbeiter*innen davon ab, Pausen einzulegen, weil sie Verdienstausfälle fürchten. Hier braucht es laut Gewerkschaften klare Gesetze, die Lohnfortzahlungen bei hitzebedingten Arbeitsunterbrechungen garantieren.
Mangelnde Informationen und unzureichende Ausrüstung verschärfen die ohnehin bestehende Belastung. »Viele wissen nicht, wie gefährlich die Hitze bei stundenlanger Feldarbeit ist«, sagt Danilova. Bei Besuchen sieht sie oft Beschäftigte ohne Kopfbedeckung oder stellt fest, dass sie keine Sonnencreme benutzen. »Sie haben kaum Schutz vor der Sonne«, sagt sie. Hautkrebs ist unter vielen Landarbeiter*innen verbreitet.
Die Hauptverantwortung zum Schutz der Beschäftigten liegt bei den Unternehmen. Sie müssen Risiken bewerten, entsprechende Maßnahmen ergreifen und ihre Belegschaft aufklären. Ein Schritt in die Richtung wurde zuletzt in Deutschland gemacht: Seit diesem Jahr gelten soziale Bedingungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Landwirtschaftliche Betriebe, die EU-Subventionen erhalten, müssen bei Verstößen gegen Arbeitsschutzrichtlinien, etwa beim Hitzeschutz, mit Rückzahlungen rechnen. »Das ist positiv«, sagt Danilova. Ob sich das in der Praxis bewähren wird, bleibt aber abzuwarten. Dafür braucht es strengere Kontrollen.
WHO und WMO fordern in ihrer Analyse Regierungen, Unternehmen und Gesundheitsbehörden weltweit dazu auf, gemeinsam mit Gewerkschaften und Expert*innen Hitze-Aktionspläne zu entwickeln. Diese sollen lokale Wetterbedingungen, Tätigkeiten und die Anfälligkeit der Beschäftigten berücksichtigen. Ersthelfer*innen, Gesundheitspersonal, Arbeitgeber*innen und Beschäftigte sollten gezielt geschult werden, um Hitzestress-Symptome erkennen und behandeln zu können. Zugleich braucht es mehr Geld für Forschung, um Hitzeschutzmaßnahmen zu verbessern und bezahlbare Methoden zur Vorhersage und Erfassung von Hitzewellen zu entwickeln, unterstreichen die Studienautor*innen.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.