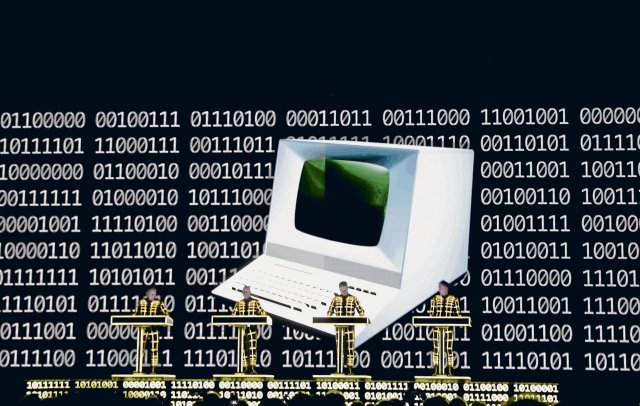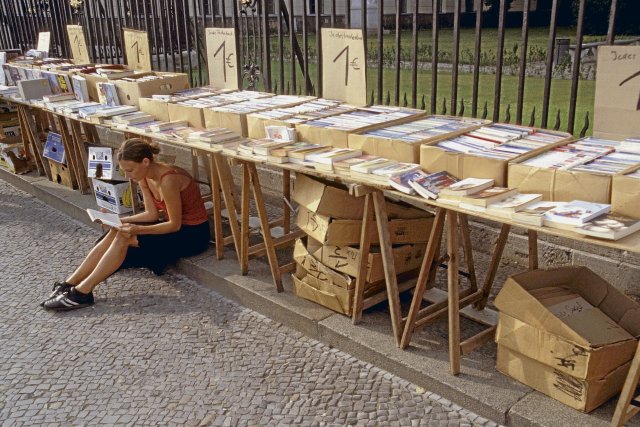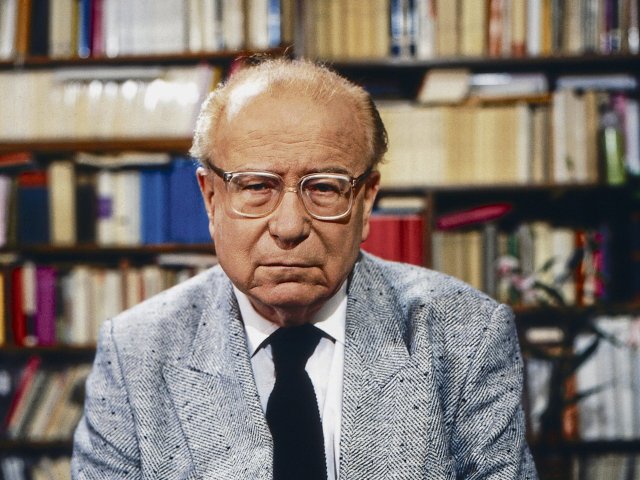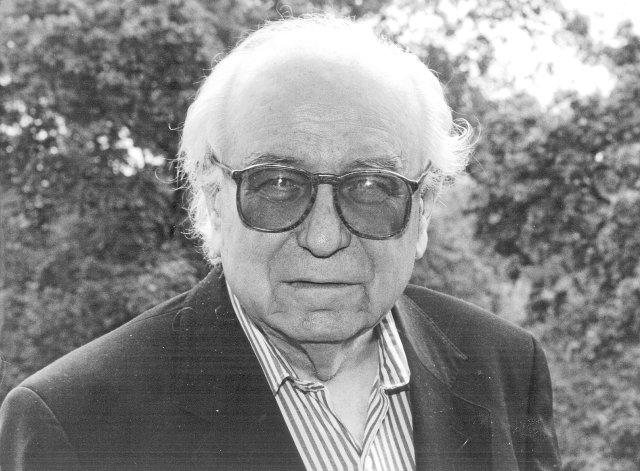- Kultur
- Neoliberalismus
Verkümmerte Systemkritik
Ein neuer Band denkt den Siegeszug des Neoliberalismus von der Schwäche der Kapitalismuskritik aus
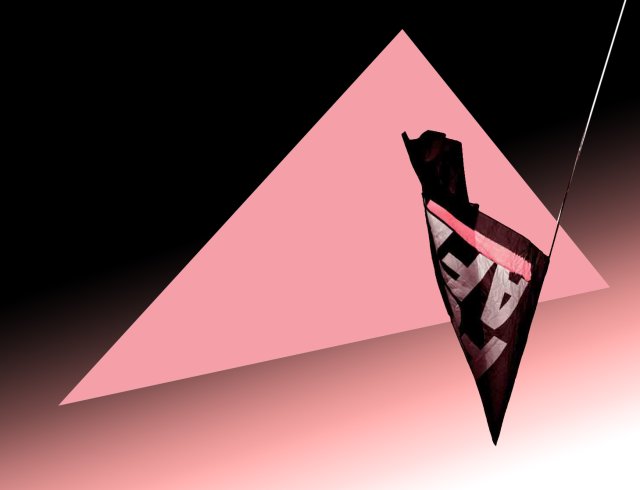
Wie kann der globale Siegeszug des Neoliberalismus ab den 70er Jahren erklärt werden? An dieser Frage beißen sich bereits seit Generationen Sozial- und Geschichtswissenschaftler*innen die Zähne aus. Das Forschungsfeld dazu lässt sich ganz grob in zwei Stränge einteilen: Einerseits betonen Erklärungsansätze die Notwendigkeiten des kapitalistischen Strukturwandels, also beispielsweise die ökonomischen Krisen der fordistischen Produktionsweise oder die bürokratische Ermüdung der Staatsapparate. Andererseits fokussieren Analysen eher ideengeschichtlich auf die Genese und Durchsetzung des neoliberalen Dogmas, wie es sich zur »Mont Pèlerin Society« oder »Chicago School« zurückverfolgen lässt. All diese Deutungen erklären den ökonomischen Strukturwandel aus sich heraus. Sie seien jedoch »unvollständig (…), solange die potenziellen Gegenspieler des Neoliberalismus und ihre Geschichte unbeachtet bleiben«.
So lautet zumindest die Ausgangsthese des kürzlich erschienenen Sammelbands »Krise der Kritik? Gegner des Kapitalismus im neoliberalen Zeitalter«, herausgegeben von Felix Dümcke, Flemming Falz und Tim Schanetzky. Die Herausgeber des Bandes gehen davon aus, dass nicht nur die Stärke des Neoliberalismus, sondern auch die Schwäche seiner Kritiker*innen analysiert werden muss, um die weitreichenden gesellschaftlichen Umbrüche ab den 70er Jahren erfassen zu können. Hervorgegangen ist das Buch aus einem Workshop des gleichnamigen geschichtswissenschaftlichen Projektverbunds am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, das sich mit dem »Formwandel« und der »Krise der Kapitalismuskritik« durch die neoliberale Umstrukturierung des Kapitalismus auseinandersetzt. Der Band versammelt dazu materialreiche Studien verschiedener kapitalismuskritischer Bewegungs- und Kritikformen der mittleren 70er Jahre bis zur Jahrtausendwende.
Von der System- zur Konsumkritik?
In der Sozialwissenschaft wird gerne der Zusammenhang von Neoliberalismus und einer »Krise der Kritik« hergestellt. Mit dieser Krise ist zumeist die Individualisierung der Kritik und der damit verbundene Bedeutungsverlust jeder fundamentalen Kapitalismuskritik gemeint. Mithilfe der historischen Beobachtungen stellen die Herausgeber diesen Zusammenhang infrage, ohne ihn gänzlich zu verwerfen. Einen Eindruck für diesen differenzierten Blick liefert der erste Beitrag »Konsumkritik und die Krise der Kapitalismuskritik« von Benjamin Möckel. Wird die Ablösung einer traditionellen »Systemkritik« durch eine individualistische »Konsumkritik« für gewöhnlich mit der Durchsetzung des Neoliberalismus erklärt, zeichnet Möckel ein ambivalenteres Bild. Bereits mit dem Wohlstandsschub der Nachkriegszeit habe sich die Konsumkritik gesellschaftlich verbreitet.
Ein eindeutiger Übergang von der »Systemkritik« hin zur Konsumkritik sei deshalb nicht nachzuweisen. Vielmehr habe die Systemkritik immer auch konsumkritische Elemente enthalten. Beispiele dafür sind Möckel zufolge die Analysen der Kritischen Theorie und der Neuen Linken, deren Beobachtungen oft an den Alltagserscheinungen der modernen »Konsumgesellschaft« ansetzten, um dadurch Rückschlüsse auf die kapitalistische Gesellschaft zu ziehen. Insgesamt sei ’68 von einer »strukturell argumentierenden Konsumkritik gekennzeichnet, die sich eben nicht trennscharf von zeitgenössischen Formen der Kapitalismuskritik abgrenzen lässt«. In der Praxis äußerte sich diese Verschiebung in alternativen Konsum- und Lebensformen.
Ein jüngeres Beispiel für die Verbindung von System- und Konsumkritik ist für Möckel die Ökologiebewegung der 80er Jahre. Hier seien gesellschaftliche Problemdiagnosen mit individuellen Konsumempfehlungen verknüpft worden. Letztlich zeigt Möckel mit diesen Beispielen, dass sowohl die strikte begriffliche Abgrenzung der Konsumkritik als auch deren Rückführung auf den Neoliberalismus zu relativieren ist. Nichtsdestotrotz gesteht der Autor ein, dass es eine Schwächung der Systemkritik ab den 70er Jahren gegeben hat. Symptomatisch dafür seien die im folgenden Jahrzehnt populär gewordenen »Ökoratgeber«, in denen die politischen Einsichten der Ökologiebewegung von ihren systemkritischen Analysen entkoppelt wurden. Übriggeblieben seien »moralische Verantwortungszuschreibungen gegenüber dem Individuum«. Vor diesem Hintergrund wäre also nicht von einem Übergang von der Systemkritik hin zur Konsumkritik, sondern von einem Formwandel der Konsumkritik und einer Schwächung der Systemkritik zu sprechen.
Abkehr vom Antikapitalismus
Nun ließe sich entgegnen, dass mit der Gründung der PDS in den 90er Jahren auch eine sozialistische Position inmitten des neoliberalen Umbaus zurückkehrte, während sich die SPD und die Grünen in dieser Zeit zunehmend marktwirtschaftlichen Prinzipien verpflichteten. Inwiefern sich diese Entwicklung in den Formwandel der Kritik einfügt, beschreibt Thorsten Holzhauser in seinem Beitrag »Zwischen Postkommunismus und Neoliberalismus«. Tatsächlich sei mit der Gründung der PDS und später der Partei Die Linke keine Rückkehr einer antikapitalistischen Fundamentalopposition verbunden gewesen. Vielmehr charakterisiert der Autor die Programmatik der PDS als eine Mischung aus »identitätspolitischen Angeboten an ›den Osten‹« und einer keynesianistischen Wirtschaftspolitik. Damit habe die Partei auch eine von der SPD unter Schröder hinterlassene Lücke für klassisch sozialdemokratische Politik gefüllt.
So wurden jedoch auch »antikapitalistische Positionen innerhalb der postkommunistischen Linken zugunsten einer moderaten Kapitalismuskritik zurückgedrängt«. Ob diese Entwicklung später auch Die Linke begleitete, bedürfte wahrscheinlich einer gesonderten Untersuchung. Vor allem, weil sich die Partei mit der Wahl von Ines Schwerdtner und Jan van Aken als Bundesvorsitzende im vergangenen Jahr wieder offensiver an antikapitalistischen Positionen auszurichten versucht.
Der Begriff Neoliberalismus kann die Umbrüche des Kapitalismus analysieren, gleichzeitig verleitet er zu einer halbierten Kritik.
Holzhausers Diagnose ist jedoch bis heute in der Linken bemerkbar: So wurde die klassische Terminologie der sozialistischen Kapitalismuskritik durch ein neues Begriffssystem ausgetauscht. Der Beitrag »Whats left?« von Agnes Arndt zeigt dies anhand des Beispiels der »Zivilgesellschaft«. Der Begriff habe den »Utopieverlust« innerhalb der Linken abfangen und die vermeintlich überholten Interpretationsschemata von der bürgerlichen Gesellschaft ablösen sollen. Gleichzeitig habe er sich aber auch zur Legitimierung der neoliberalen Umstrukturierung geeignet. Wo die zivilgesellschaftliche Verantwortung angerufen wurde, bereitete man meistens den Abbau des Sozialstaats vor.
Diese Ambivalenz zeichnet auch den Begriff des Neoliberalismus aus: Eignete er sich auf der einen Seite dafür, die Umbrüche des Kapitalismus zu analysieren, verleitete er gleichzeitig zu einer halbierten Kritik. Statt sich gegen den Kapitalismus als Ganzes zu richten, wurde nur noch der Neoliberalismus als eine spezifische Variante kritisiert. Wie Holzhauser schreibt, »klang das Wort Neoliberalismus nach den terminologischen und ideologischen Abnutzungskämpfen des ausgehenden 20. Jahrhunderts weniger verbraucht, und es wirkte auch stärker integrierend, weil es reale Deutungsgegensätze innerhalb der politischen Linken zu überspielen vermochte«.
Kritik des Neoliberalismus
Dass der Begriff des Neoliberalismus auch als wissenschaftliche Analysekategorie einige Schwachstellen aufweist, zeigt Roman Köster in seiner Begriffsreflexion. Schließlich stelle der Neoliberalismus sowohl auf theoretischer als auch auf historischer Ebene ein weniger kohärentes Projekt dar als gemeinhin angenommen. Gleichzeitig neige die soziologische Literatur dazu, den »Kapitalismus der 60er und 70er Jahre zu einer heilen Welt mit Arbeitnehmerrechten, auskömmlichen Löhnen und funktionierenden Infrastrukturen zu stilisieren«. Der Beitrag »Sozialstaatskritik statt Kapitalismuskritik« von Flemming Falz zeigt anhand der wohnungspolitischen Neuerungen der britischen Labour-Partei zwischen 1979 und 1997, dass die marktliberale Umgestaltung des Wohnungsmarktes jedoch eine Reaktion auf bereits bestehende Missverhältnisse in der Wohnungspolitik gewesen ist.
Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Alternativen zu neoliberaler Politik gegeben hätte, wohl aber, dass sich die neoliberale Wende nicht überall auf den Siegeszug konservativer Kräfte reduzieren lässt. Vielmehr zeigen die historischen Studien, dass es nicht selten sozialdemokratische oder linksliberale Kräfte waren, welche die neoliberalen Strukturreformen implementierten und damit auf bestehende Krisen reagierten. Die Linke vermochte es dabei nicht, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Beiträge des Sammelbands verdeutlichen dieses Scheitern, indem sie den Zusammenhang zwischen neoliberalem Umbruch und der Kritik an diesem exemplarisch rekonstruieren. Mehr noch: Sie zeigen, dass die Kritik des Neoliberalismus selbst schon Ausdruck eines Formwandels der Kritik ist. Zwar stellen die Autor*innen die daraus entstehenden Probleme überzeugend dar. Allerdings verbleiben sie weitgehend auf der Ebene der historischen Analyse. Für die Maßstäbe einer wirklich progressiven Kapitalismuskritik bedürfte es jedoch eines theoretischen Bezugs auf die Ökonomiekritik. Wer diesen mitdenken kann, wird in dem Buch wertvolle Anhaltspunkte für die Krise der Kapitalismuskritik – und daher auch der Linken – finden.
Felix Dümcke, Flemming Falz, Tim Schanetzky (Hg.): Krise der Kritik? Gegner des Kapitalismus im neoliberalen Zeitalter. Wallstein, 355 S., geb., 38 €.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.